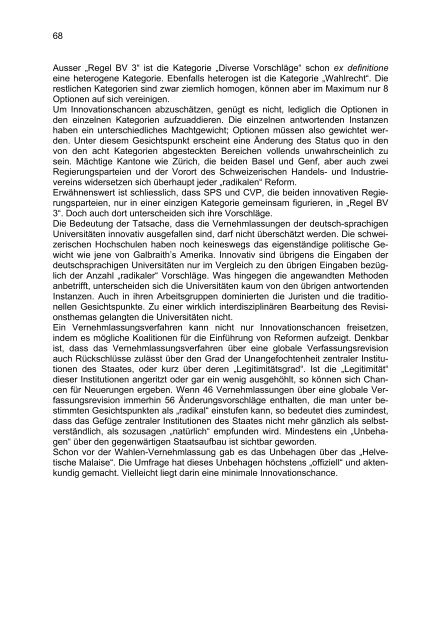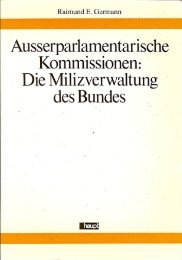Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
68<br />
Ausser „Regel BV 3“ ist die Kategorie „Diverse Vorschläge“ schon ex definitione<br />
eine heterogene Kategorie. Ebenfalls heterogen ist die Kategorie „Wahlrecht“. Die<br />
restlichen Kategorien sind zwar ziemlich homogen, können aber im Maximum nur 8<br />
Optionen auf sich vereinigen.<br />
Um <strong>Innovation</strong>schancen abzuschätzen, genügt es nicht, lediglich die Optionen in<br />
den einzelnen Kategorien aufzuaddieren. Die einzelnen antwortenden Instanzen<br />
haben ein unterschiedliches Machtgewicht; Optionen müssen also gewichtet werden.<br />
Unter diesem Gesichtspunkt erscheint eine Änderung des Status quo in den<br />
von den acht Kategorien abgesteckten Bereichen vollends unwahrscheinlich zu<br />
sein. Mächtige Kantone wie Zürich, die beiden Basel <strong>und</strong> Genf, aber auch zwei<br />
Regierungsparteien <strong>und</strong> der Vorort des Schweizerischen Handels- <strong>und</strong> Industrievereins<br />
widersetzen sich überhaupt jeder „radikalen“ Reform.<br />
Erwähnenswert ist schliesslich, dass SPS <strong>und</strong> CVP, die beiden innovativen Regierungsparteien,<br />
nur in einer einzigen Kategorie gemeinsam figurieren, in „Regel BV<br />
3“. Doch auch dort unterscheiden sich ihre Vorschläge.<br />
Die Bedeutung der Tatsache, dass die Vernehmlassungen der deutsch-sprachigen<br />
Universitäten innovativ ausgefallen sind, darf nicht überschätzt werden. Die schweizerischen<br />
Hochschulen haben noch keineswegs das eigenständige politische Gewicht<br />
wie jene von Galbraith’s Amerika. Innovativ sind übrigens die Eingaben der<br />
deutschsprachigen Universitäten nur im Vergleich zu den übrigen Eingaben bezüglich<br />
der Anzahl „radikaler“ Vorschläge. Was hingegen die angewandten Methoden<br />
anbetrifft, unterscheiden sich die Universitäten kaum von den übrigen antwortenden<br />
Instanzen. Auch in ihren Arbeitsgruppen dominierten die Juristen <strong>und</strong> die traditionellen<br />
Gesichtspunkte. Zu einer wirklich interdisziplinären Bearbeitung des Revisionsthemas<br />
gelangten die Universitäten nicht.<br />
Ein Vernehmlassungsverfahren kann nicht nur <strong>Innovation</strong>schancen freisetzen,<br />
indem es mögliche Koalitionen für die Einführung von Reformen aufzeigt. Denkbar<br />
ist, dass das Vernehmlassungsverfahren über eine globale Verfassungsrevision<br />
auch Rückschlüsse zulässt über den Grad der Unangefochtenheit zentraler Institutionen<br />
des Staates, oder kurz über deren „Legitimitätsgrad“. Ist die „Legitimität“<br />
dieser Institutionen angeritzt oder gar ein wenig ausgehöhlt, so können sich Chancen<br />
für Neuerungen ergeben. Wenn 46 Vernehmlassungen über eine globale Verfassungsrevision<br />
immerhin 56 Änderungsvorschläge enthalten, die man unter bestimmten<br />
Gesichtspunkten als „radikal“ einstufen kann, so bedeutet dies zumindest,<br />
dass das Gefüge zentraler Institutionen des Staates nicht mehr gänzlich als selbstverständlich,<br />
als sozusagen „natürlich“ empf<strong>und</strong>en wird. Mindestens ein „Unbehagen“<br />
über den gegenwärtigen Staatsaufbau ist sichtbar geworden.<br />
Schon vor der Wahlen-Vernehmlassung gab es das Unbehagen über das „Helvetische<br />
Malaise“. Die Umfrage hat dieses Unbehagen höchstens „offiziell“ <strong>und</strong> aktenk<strong>und</strong>ig<br />
gemacht. Vielleicht liegt darin eine minimale <strong>Innovation</strong>schance.