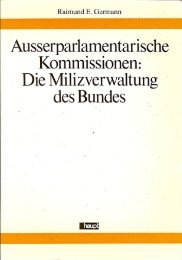Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
160<br />
ing to the fore any issues that might in their resolution be seriously detrimental<br />
to A’s set of preferences.“ 3<br />
Noch ist umstritten, ob sich das Konzept der nondecision für exakte empirische<br />
Untersuchungen eignet oder nicht. 4 Für eine Verfassungsdiskussion halten wir es<br />
jedoch für ausserordentlich fruchtbar. Es lenkt nämlich das Augenmerk auf politische<br />
Wertungen, Rituale, Verfahrensnormen <strong>und</strong> vor allem politische Institutionen,<br />
die geeignet sind, die Austragung bestimmter Kontroversen zu befördern oder zu<br />
behindern.<br />
Bachrach <strong>und</strong> Baratz schlagen vor, bei der Analyse von Machtverteilungen vorerst<br />
zu fragen, zu wessen Gunsten die Spielregeln in der betreffenden Organisation<br />
gewichtet sind. Von dieser Fragestellung wollen wir hier ausgehen. Unsere These<br />
besagt, dass das derzeitige Institutionengefüge im Regierungssystem der Schweiz<br />
die status-quo-orientierten Gruppierungen begünstigt <strong>und</strong> innovative Kräfte entsprechend<br />
an den kürzeren Hebelarm setzt, <strong>und</strong> dies in einem stärkeren Ausmass als in<br />
andern vergleichbaren westlichen Industrienationen. Die Spielregeln gewähren<br />
jenen Gruppierungen, die sich einer Neuerung widersetzen wollen, zahlreiche kumulierbare<br />
Möglichkeiten, einen Vorstoss zu Fall zu bringen oder auf „unschädliche“<br />
Dimensionen zurückzustufen oder ihn überhaupt nicht erst zur Sprache kommen<br />
zu lassen. Es ist anzunehmen, dass oft die blosse Einschätzung dieser ungünstigen<br />
Erfolgschancen Neuerer davon abhält, Vorschläge ins Forum zu bringen<br />
oder auch nur solche auszuarbeiten.<br />
(1) Referendum <strong>und</strong> Initiative 5<br />
Am ausgeprägtesten begünstigt auf B<strong>und</strong>esebene die Institution desfakultativen<br />
Gesetzesreferendums die Kräfte des Beharrens. Leonhard Neidhart weist darauf<br />
hin, dass „eigentlich in der gesamten einschlägigen Literatur“ die konservativretardierende<br />
Funktion des fakultativen Referendums hervorgehoben wird, <strong>und</strong> zwar<br />
schon seit der Zeit kurz nach Einführung dieser Institution im Jahre<br />
3 Peter Bachrach/Morton S. Baratz, „Two Faces of Power“, APSR, Vol. 56, No. 4, Dezember 1962, S.<br />
947-952. Siehe auch: dieselben, „Decisions and Nondecisions: An Analytical Framework“, APSR, Vol.<br />
57, No. 3, September 1963, S. 632-642; dieselben, Power and Poverty: Theory and Practice, Oxford<br />
University Press, New York, 1970. Nondecision-making definieren die beiden Autoren u. a. wie folgt:<br />
als den Prozess, durch welchen „. . . status quo oriented persons and groups influence those community<br />
values and those political institutions . . . which tend to limit the scope of actual decisionmaking to<br />
‘safe’ issues“. Oder sie halten eine Situation des nondecision-making dann für gegeben, „when the<br />
dominant values, the accepted rules of the game, the existing power relations among groups, and the<br />
instruments of force, singly or in combination, effectively prevent certain grievances from developing into<br />
full-fledged issues which call for decisions“.<br />
4 Skepsis über die Forschungstauglichkeit des Konzepts äusserte: Raymond E. Wolfinger, „Nondecisions<br />
and the Study of Local Politics“, APSR, Vol. 65, No.4, Dezember 1971, S. 1063–1080. Befürwortend<br />
äusserte sich: Frederick W. Frey, „Comment: On Issues and Nonissues in the Study of Power“,<br />
APSR, Vol. 65, No. 4, Dezember 1971, S. 1081–1101.<br />
5 Über die im Laufe der Generationen sich wandelnden Theorien <strong>und</strong> Einschätzungen der schweizerischen<br />
„direktdemokratischen“ Institutionen bei Juristen, Historikern <strong>und</strong> Politologen siehe die ausgezeichnete<br />
Zusammenfassung: Roland Ruffieux, „Le référendum en tant que décision“, in: Ruffieux et<br />
al., La démocratie référendaire en Suisse au XXe siècle. Tome l: Analyse de cas, Fribourg 1972, S.<br />
14–31. – Während Ruffieux <strong>und</strong> seine Mitarbeiter das Referendum „en tant que décision“ untersuchen,<br />
sind im folgenden die direktdemokratischen Institutionen als Ursache von nondecision making diskutiert.