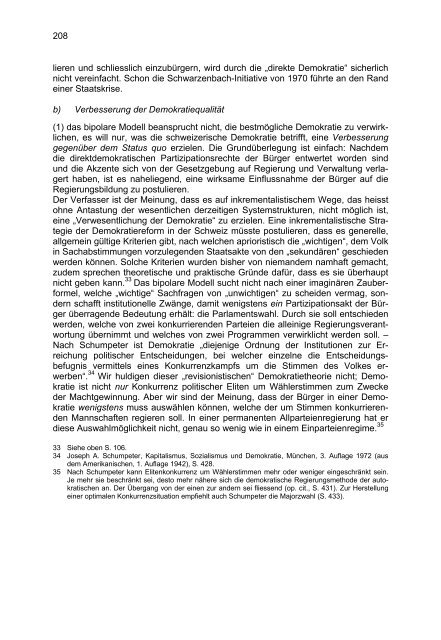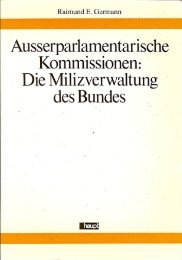Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
208<br />
lieren <strong>und</strong> schliesslich einzubürgern, wird durch die „direkte Demokratie“ sicherlich<br />
nicht vereinfacht. Schon die Schwarzenbach-Initiative von 1970 führte an den Rand<br />
einer Staatskrise.<br />
b) Verbesserung der Demokratiequalität<br />
(1) das bipolare Modell beansprucht nicht, die bestmögliche Demokratie zu verwirklichen,<br />
es will nur, was die schweizerische Demokratie betrifft, eine Verbesserung<br />
gegenüber dem Status quo erzielen. Die Gr<strong>und</strong>überlegung ist einfach: Nachdem<br />
die direktdemokratischen Partizipationsrechte der Bürger entwertet worden sind<br />
<strong>und</strong> die Akzente sich von der Gesetzgebung auf Regierung <strong>und</strong> Verwaltung verlagert<br />
haben, ist es naheliegend, eine wirksame Einflussnahme der Bürger auf die<br />
Regierungsbildung zu postulieren.<br />
Der Verfasser ist der Meinung, dass es auf inkrementalistischem Wege, das heisst<br />
ohne Antastung der wesentlichen derzeitigen Systemstrukturen, nicht möglich ist,<br />
eine „Verwesentlichung der Demokratie“ zu erzielen. Eine inkrementalistische Strategie<br />
der Demokratiereform in der Schweiz müsste postulieren, dass es generelle,<br />
allgemein gültige Kriterien gibt, nach welchen aprioristisch die „wichtigen“, dem Volk<br />
in Sachabstimmungen vorzulegenden Staatsakte von den „sek<strong>und</strong>ären“ geschieden<br />
werden können. Solche Kriterien wurden bisher von niemandem namhaft gemacht,<br />
zudem sprechen theoretische <strong>und</strong> praktische Gründe dafür, dass es sie überhaupt<br />
nicht geben kann. 33 Das bipolare Modell sucht nicht nach einer imaginären Zauberformel,<br />
welche „wichtige“ Sachfragen von „unwichtigen“ zu scheiden vermag, sondern<br />
schafft institutionelle Zwänge, damit wenigstens ein Partizipationsakt der Bürger<br />
überragende Bedeutung erhält: die Parlamentswahl. Durch sie soll entschieden<br />
werden, welche von zwei konkurrierenden Parteien die alleinige Regierungsverantwortung<br />
übernimmt <strong>und</strong> welches von zwei Programmen verwirklicht werden soll. –<br />
Nach Schumpeter ist Demokratie „diejenige Ordnung der Institutionen zur Erreichung<br />
politischer Entscheidungen, bei welcher einzelne die Entscheidungsbefugnis<br />
vermittels eines Konkurrenzkampfs um die Stimmen des Volkes erwerben“.<br />
34 Wir huldigen dieser „revisionistischen“ Demokratietheorie nicht; Demokratie<br />
ist nicht nur Konkurrenz politischer Eliten um Wählerstimmen zum Zwecke<br />
der Machtgewinnung. Aber wir sind der Meinung, dass der Bürger in einer Demokratie<br />
wenigstens muss auswählen können, welche der um Stimmen konkurrierenden<br />
Mannschaften regieren soll. In einer permanenten Allparteienregierung hat er<br />
diese Auswahlmöglichkeit nicht, genau so wenig wie in einem Einparteienregime. 35<br />
33 Siehe oben S. 106.<br />
34 Joseph A. Schumpeter, Kapitalismus, Sozialismus <strong>und</strong> Demokratie, München, 3. Auflage 1972 (aus<br />
dem Amerikanischen, 1. Auflage 1942), S. 428.<br />
35 Nach Schumpeter kann Elitenkonkurrenz um Wählerstimmen mehr oder weniger eingeschränkt sein.<br />
Je mehr sie beschränkt sei, desto mehr nähere sich die demokratische Regierungsmethode der autokratischen<br />
an. Der Übergang von der einen zur andern sei fliessend (op. cit., S. 431). Zur Herstellung<br />
einer optimalen Konkurrenzsituation empfiehlt auch Schumpeter die Majorzwahl (S. 433).