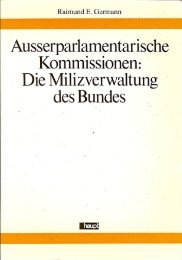Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
196<br />
Unsere Annahme, dass mit der Einführung des relativen Mehrheitswahlrechts ein<br />
signifikanter Einfluss in Richtung auf ein Zweiparteiensystem ausgeübt werden<br />
kann, lässt sich auf der Gr<strong>und</strong>lage des vorhandenen empirischen Materials durchaus<br />
vertreten. Kaum umstritten ist auch die Vorstellung, dass mit diesem Wahlsystem<br />
die Bildung einer stabilen Einparteienregierung <strong>und</strong> einer wirksamen Opposition<br />
mit der Chance von Machtwechseln gefördert werden kann. Das britische Beispiel<br />
berechtigt zur Erwartung, dass schon relativ geringe Stimmenverschiebungen<br />
einen Machtwechsel bewirken können <strong>und</strong> dass in der Regel schon ein geringer<br />
Stimmenvorsprung der siegreichen Partei sich in eine solide Sitzmehrheit im Parlament<br />
übersetzt (Kubusregel). 15 Nach Rae gilt:<br />
„Plurality and majority formulae tend to magnify changes in the popular support<br />
of parties when legislative seats are allocated, but P. R. systems generally have<br />
no such effect.“ 16<br />
In der neueren Literatur herrscht die „funktionelle Betrachtungsweise“ bei der Einschätzung<br />
von Wahlsystemen vor; dieses soll in erster Linie dazu dienen, handlungsfähige<br />
Regierungen <strong>und</strong> kohärente Oppositionen zu schaffen sowie den Wählern<br />
die Möglichkeit einräumen, mit dem Wahlzettel möglichst direkt die Regierungsmannschaft<br />
zu bestimmen. Mit der funktionellen Betrachtungsweise aber<br />
erhält der Majorz wieder neuen Auftrieb, der nach dem ersten Weltkrieg in fast allen<br />
kontinentaleuropäischen Ländern, so auch in der Schweiz, abgeschafft wurde. 17 –<br />
In der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland empfahl 1968 eine von der Regierung eingesetzte<br />
Expertenkommission die Einführung des relativen Mehrheitswahlrechts. 18 Für<br />
Österreich schlug Karl-Heinz Nassmacher das relative Mehrheitswahlrecht in Einerwahlkreisen<br />
vor, um die Voraussetzungen für ein „alternierendes Regierungssystem“<br />
englischen Musters zu schaffen <strong>und</strong> um es der Wählerschaft zu ermöglichen,<br />
als „ultimate authority“ unmittelbar<br />
Zur Berechnung von Fe gilt folgende Formel:<br />
wobei Tj der Stimmenanteil in Prozent ist, den irgendeine der beteiligten Parteien erreicht (analoge<br />
Formel für Fp). – Der Fe-Wert, der optimal unserem operationalen Ziel entspricht, beträgt 0,5. Die Untersuchung<br />
von Rae hat nun ergeben, dass der durchschnittliche Fe-Wert bei den Systemen mit relativer<br />
oder absoluter Mehrheitswahl 0,54 beträgt, bei Proporzsystemen dagegen 0,73. Der durchschnittliche<br />
Fp-Wert bei den Majorzwahlsystemen beträgt nur 0,51, während er bei den Proporzsystemen<br />
0,70 ausmacht. – Nach Rae gilt auch: Je kleiner die Wahlkreise, desto geringer die Fraktionalisierung.<br />
Bei Einerwahlkreisen, was wir vorschlagen, errechnete Rae einen durchschnittlichen Fe-<br />
Wert von 0,548 <strong>und</strong> einen Fp-Wert von 0,508 (op. cit., S. 120 f.).<br />
15 Die Kubusregel besagt, dass bei relativer Mehrheitswahl in Einerwahlkreisen bei Zweiparteienkonkurrenz<br />
die Mandatzahlen der beiden Parteien sich normalerweise verhalten wie die dritten Potenzen<br />
ihrer Stimmenanteile. Siehe: Duverger, Partis Politiques (op. cit.), S. 356; Rae, op. cit., S. 27. Siehe<br />
auch: Edward R. Tufte, „The Relationship Between Seats and Votes in Two-Party Systems“, APSR,<br />
Vol. 67, No. 2, Juni 1973, S. 540-554.<br />
16 Rae, op cit., S. 101.<br />
17 Siehe: Ferdinand A. Hermens, Demokratie oder Anarchie Untersuchung über die Verhältniswahl,<br />
Köln/Opladen, 2. Auflage 1968; Jean-Marie Cotteret/Claude Emeri, Les systèmes électoraux, („Que<br />
sais-je „ Nr. 13821, Paris 1970, S. 68 ff.; Heino Kaack, Zwischen Verhältniswahl <strong>und</strong> Mehrheitswahl,<br />
Opladen 1967, S. 65.<br />
18 Zur Neugestaltung des B<strong>und</strong>estagswahlrechts. Bericht des vom B<strong>und</strong>esminister des Innern eingesetzten<br />
Beirats für Fragen der Wahlrechtsreform, Bonn 1968.