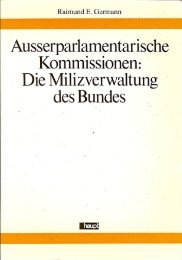Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
72<br />
Probleme des Regierungssystems einzugehen. – Es ist indessen hervorzuheben,<br />
dass der Vorort des Schweizerischen Handels- <strong>und</strong> Industrievereins, die wohl<br />
mächtigste Interessenorganisation in der Schweiz, dem ganzen Revisionsunternehmen<br />
sein apodiktisches Nein entgegensetzte.<br />
Die grossen Interessenorganisationen aus dem gesamten Revisionsverfahren herauszuhalten,<br />
wäre im schweizerischen Kontext wohl ein Ding der Unmöglichkeit.<br />
Hingegen wäre die Option, in der Anfangsphase nur die Kantone, Parteien <strong>und</strong><br />
Universitäten zu konsultieren, nicht nur offengestanden, sondern im Interesse minimaler<br />
Erfolgschancen des Unternehmens sogar dringend geboten gewesen. Die<br />
Anfangsphase, so wie sie von der Wahlen-Kommission strukturiert wurde, zeichnete<br />
sich nämlich durch Konfusion, Konturenlosigkeit <strong>und</strong> somit grosse Verletzlichkeit<br />
aus. Sie produzierte zahlreiche sich widersprechende Vorschläge <strong>und</strong> Ideen <strong>und</strong><br />
vermochte nicht zu einer „Leitidee“ für die Totalrevision vorzustossen. Bereits in<br />
diesem konfusen <strong>und</strong> labilen Stadium den grossen Interessenorganisationen zu<br />
gestatten, ihr Veto in aller Form anzubringen, bedeutete einen vorzeitigen Verzicht<br />
auf jede Erfolgsaussicht. Das Veto eines Spitzenverbandes in einem Zeitpunkt, da<br />
bereits konkrete Reformideen sich herauskristallisiert haben, hätte wahrscheinlich<br />
eine geringere Durchschlagskraft gehabt als in einer konfusen Anfangsphase.<br />
Atypisch im Vorgehen der Wahlen-Kommission war es, dass sie anfänglich versuchte,<br />
die Spitzenverbände der Wirtschaft aus dem Vernehmlassungsverfahren<br />
herauszuhalten; denn diese Verbände spielen in „normalen“ Verfahren meistens<br />
eine dominierende Rolle. Die Kommission konnte indessen ihren Standpunkt unter<br />
dem Druck des Vororts nicht aufrecht erhalten.<br />
c) Das Abgleiten ins „normale“ Verfahren<br />
Die Wahlen-Kommission lud in der zweiten Hälfte des November 1967 die Kantone,<br />
Parteien <strong>und</strong> Universitäten offiziell ein, den Fragenkatalog zu beantworten. Am 27.<br />
November 1967 übergab die Kommission den Katalog im Rahmen einer Pressekonferenz<br />
der Öffentlichkeit. 10 Mehrere Tageszeitungen <strong>und</strong> Zeitschriften veröffentlichten<br />
in der Folge den Katalog im Wortlaut, die „Neue Zürcher Zeitung“ beispielsweise<br />
am 2. Dezember 1967. In ihrer Nummer vom 7. Dezember 1967 kritisierte die<br />
„Schweizerische Arbeitgeber-Zeitung“ das Vorgehen der Wahlen-Kommission <strong>und</strong><br />
führte unter anderem folgendes aus:<br />
„Deshalb überrascht die Auswahl der Adressaten, die zu diesem Fragenkatalog<br />
offiziell Stellung beziehen dürfen. Es sind dies die Kantone, die politischen Parteien<br />
<strong>und</strong> die Universitäten. Weder die Spitzenorganisationen der Unternehmerschaft<br />
noch die Gewerkschaften werden zur Stellungnahme eingeladen.<br />
Begründet wird dieser Ausschluss der wirtschaftlichen Organisationen damit,<br />
dass die Totalrevision der B<strong>und</strong>esverfassung politisch-wissenschaftlichen Charakter<br />
habe <strong>und</strong> deshalb nur ausgesprochen politische Gremien <strong>und</strong> die Wissenschaft<br />
in der Lage seien, sachk<strong>und</strong>ig mitzuwirken. Dabei schimmert in einzelnen<br />
Kommentaren eine deutliche Genugtuung über<br />
10 Antworten I, S. 12.