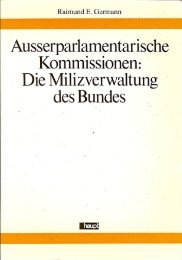Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
187<br />
b) Dle Beseitigung der lnstitutlönellen „Konkordanzzwänge“<br />
In langsamer Entwicklung bildete sich in der Schweiz eine ständig verfeinerte partei-<br />
<strong>und</strong> interessenpolitische Proportionalisierung aller wesentlichen Staatsorgane<br />
sowie spezifische Konfliktsregelungsmuster heraus, wofür man den Ausdruck „Konkordanzdemokratie“<br />
geprägt hat. Ihren Höhepunkt findet sie in der 1959 installierten<br />
Allparteienregierung. – Bei der Diskussion der Konkordanzpolitik herrschen in der<br />
neueren Literatur zwei Tendenzen vor. Die eine sieht darin eine „in der Geschichte<br />
tief verwurzelte“ kulturelle Eigenart der Schweiz, die weiter nicht erklärungsbedürftig<br />
ist, sondern zur Erklärung anderer politischer Phänomene dient. Nach Steiner ist<br />
der Proporz-B<strong>und</strong>esrat nach der Formel von 1959 die krönende Vollendung eines<br />
Gr<strong>und</strong>musters „gütlichen Einvernehmens“, das – seit 1291! – „die eidgenössische<br />
Geschichte wie ein roter Faden durchzieht“. 4 Die andere Tendenz sieht in institutionellen<br />
Faktoren, insbesondere im Referendum, eine eigenständige Ursache für die<br />
Herausbildung der Konkordanzpolitik. 5 Es ist in der Tat naheliegender, die erstmalige<br />
Wahl eines Katholisch-Konservativen in den B<strong>und</strong>esrat im Jahre 1891 auf dem<br />
Hintergr<strong>und</strong> der damaligen Referendumsstrategie der Konservativen zu sehen, als<br />
das geheimnisvolle Keimen eines nationalen Prinzips zu postulieren. Auch für die<br />
„Zauberformel“, die seit 1959 den Sozialdemokraten einen proportionalen Sitzanteil<br />
im B<strong>und</strong>esrat einräumt, lassen sich, wie zu zeigen sein wird, durchaus prosaische<br />
Erklärungen anführen.<br />
In diesem Zusammenhang spielen indessen die möglichen Ursachen <strong>und</strong> die Genese<br />
der heutigen Konkordanzpolitik nur eine untergeordnete Rolle. Wesentlicher<br />
dürfte die Feststellung sein, dass ohne gr<strong>und</strong>legende Verfassungsänderung ein<br />
Abgehen von Konkordanz <strong>und</strong> Allparteienregierung praktisch unmöglich ist. Die<br />
Option für einen Regierungsmodus, der mit einem geringeren Konsensbedarf auskommt,<br />
wie es unser operationales Ziel postuliert, ist von Verfassungs wegen verbaut.<br />
– Selbst wenn die Schweiz ein Zweiparteiensystem gemäss Operationalisierung<br />
(2) besässe, müsste eine Grosse Koalition perpetuiert werden, weil nicht<br />
beide Parteien gleiche Chancen zur alleinigen Führung der Regierungsgeschäfte<br />
besässen. Der „progressiven“ Partei wäre es kaum möglich, in beiden Kammern die<br />
Mehrheit zu erringen. Und die „konservative“ Partei wäre in der Opposition gar nicht<br />
vorstellbar, weil sie durch obstruktiven Gebrauch des Referendums die Regierung<br />
jederzeit lahmlegen könnte. Theoretisch wäre die Alleinherrschaft der „konservativen“<br />
Partei für einige Zeit denkbar, weil das Referendum als Kampfinstrument für<br />
eine „progressive“ Oppositionspartei von beschränktem Nutzen ist. 6 Im Falle von<br />
„Abnützungserscheinungen“ bei der „konservativen“ Regierungspartei böte die<br />
„progressive“ Partei, die aus den schon erwähnten Gründen nicht regierungsfähig<br />
wäre, jedoch<br />
4 Steiner, Gewaltlose Politik (op. cit.), S. 36-38. Ähnlich: Gerhard Lehmbruch, Proporzdemokratie.<br />
<strong>Politische</strong>s System <strong>und</strong> politische Kultur in der Schweiz <strong>und</strong> in Österreich,Tübingen 1967, S. 15-19. Allerdings<br />
erwähnt dieser Autor beiläufig auch das Referendum als Ursache für die Herausbildung typisch<br />
schweizerischer Konfliktregelungsmuster (S. 50).<br />
5 Neidhart, Plebiszit (op. cit.). Siehe auch: Heinz Niemetz, „Zur schweizerischen Konkordanzdemokratie“,<br />
Schweizer R<strong>und</strong>schau, Nr. 2, 1970. Dieser Autor führt die schweizerischen Konfliktregelungsmuster<br />
nicht nur auf die politische Kultur, sondern nachdrücklich auch auf die Institution des fakultativen Referendums<br />
zurück (Sonderdruck S. 18).<br />
6 Siehe oben S. 160 ff.