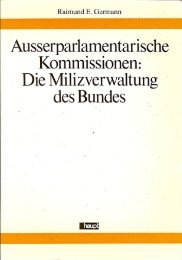Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
148<br />
Vetopositionen, Kompromisszwang, referendumstechnische Überlegungen sowie<br />
die meist hohe Komplexität der Materie zwingen den Gesetzgeber, zentrale Punkte<br />
aus dem Gesetz auszuklammern, grosszügige Ausweichklauseln einzufügen, im<br />
Belanglosen sehr detailliert <strong>und</strong> im Wichtigen sehr vage zu formulieren. Strittige<br />
Punkte müssen auf die Verordnungsstufe delegiert werden, oder ihre Lösung wird<br />
nur in Umrissen angedeutet, die konkrete Ausgestaltung dagegen im Namen des<br />
Föderalismus den Kantonen überlassen. Schindler spricht von der „Aushöhlung<br />
manchen Gesetzes durch den Delegationsweg“. 9 In dem äusserst wichtigen, neuralgischen<br />
Gesetzgebungsbereich der Raumplanung wurde der B<strong>und</strong> von Verfassungs<br />
wegen gar nur auf den Erlass von „Gr<strong>und</strong>sätzen“ reduziert (Art. 22quater<br />
BV). Die Juristen betonen, dass Planungsgr<strong>und</strong>sätze des B<strong>und</strong>es einen „hohen<br />
Abstraktionsgrad“ haben müssen. Kein Zweifel kann darüber bestehen, dass solche<br />
Gr<strong>und</strong>sätze eine nur geringe Normierungs- <strong>und</strong> Gestaltungskraft besitzen. – Theodore<br />
Lowi stellt fest, dass in Systemen von lnterest Group Liberalism der Gesetzgeber<br />
sich darauf beschränkt, den Vollzugsorganen Problemkataloge <strong>und</strong> Geld zur<br />
Verfügung zu stellen; was damit gemacht wird, entzieht sich seiner Gestaltungskraft.<br />
Die konkreten Resultate, die herauskommen, werden nicht vom Willen des<br />
Gesetzgebers, sondern vom Bargaining der Direktinteressierten bestimmt. 10 Ist<br />
diese Tendenzbeschreibung richtig, so verlieren Referendumsentscheide zusehends<br />
den Charakter von „Sachentscheiden“; denn selbst der wohlinformierte Fachmann<br />
kann bei der Lektüre eines Gesetzes keine Prognose mehr wagen, welche<br />
Auswirkungen der Erlass haben wird. Referendumsentscheide werden vielmehr zur<br />
„Delegation von Vertrauen“ an den Vollzugsapparat innerhalb eines bestimmten<br />
Tätigkeitsbereiches. Mit der Formel „Delegation generalisierten Vertrauens“ wird<br />
normalerweise die Bedeutung von allgemeinen Wahlen in Massendemokratien<br />
umschrieben. 11 Keineswegs darf jedoch die Vertrauensdelegation im Referendumsentscheid<br />
als äquivalent mit jener bei allgemeinen Wahlen betrachtet werden. Das<br />
Korrelat zum Vertrauen, nämlich das Misstrauen, kann im Referendumsentscheid<br />
nicht ausgedrückt werden. Jede beliebige Interpretation eines negativen Referendumsentscheides<br />
ist in der Schweiz möglich, nur nicht jene, dass die in Frage stehende<br />
Behördenorganisation das Vertrauen des Volkes nicht mehr geniesse. Damit<br />
das politische System überhaupt funktionieren kann, dürfen negative Referendumsentscheide<br />
nicht als Vertrauensentzug aufgefasst werden, dürfen sie keine<br />
personelle Konsequenzen haben. Pointiert ausgedrückt geht es bei Referenda über<br />
komplexe Vorlagen wie Planungsgesetze vorwiegend darum, ob das Volk schon<br />
bereit ist, den zuständigen Behördenapparat zu akklamieren. Verweigert es die<br />
Akklamation, so wird ihm Gelegenheit geboten, sie später nachzuholen.<br />
(3) Dass Referendumsabstimmungen zu Akklamationsübungen werden, mag ein<br />
Extremfall darstellen. Sicherlich dürfen wir jedoch von der Annahme ausgehen,<br />
dass die Abstimmungsvorlagen die Tendenz haben, komplizierter <strong>und</strong> schwerer<br />
durchschaubar zu werden. Dietrich Schindler bemerkte:<br />
9 Schindler, op. cit., S. 122.<br />
10 Lowi, op. cit., Kapitel 5 „Liberal Jurisprudence: Policy Without Law“, S. 125–156; ebenfalls: S. 290.<br />
11 Fritz Scharpf, Demokratietheorie zwischen Utopie <strong>und</strong> Anpassung, Konstanz 1970, S. 91.