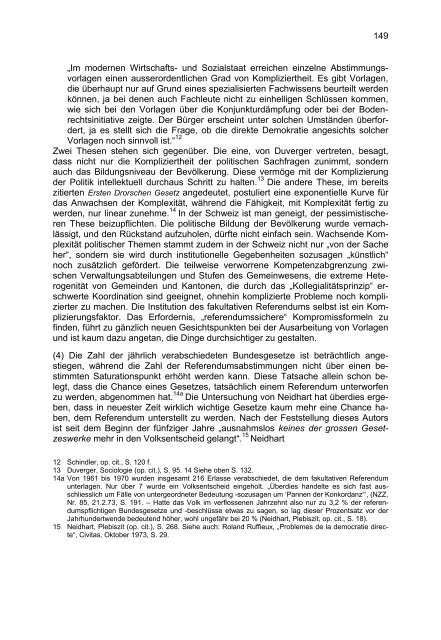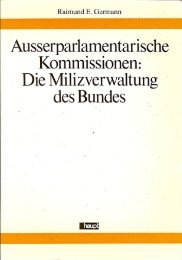Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
149<br />
„Im modernen Wirtschafts- <strong>und</strong> Sozialstaat erreichen einzelne Abstimmungsvorlagen<br />
einen ausserordentlichen Grad von Kompliziertheit. Es gibt Vorlagen,<br />
die überhaupt nur auf Gr<strong>und</strong> eines spezialisierten Fachwissens beurteilt werden<br />
können, ja bei denen auch Fachleute nicht zu einhelligen Schlüssen kommen,<br />
wie sich bei den Vorlagen über die Konjunkturdämpfung oder bei der Bodenrechtsinitiative<br />
zeigte. Der Bürger erscheint unter solchen Umständen überfordert,<br />
ja es stellt sich die Frage, ob die direkte Demokratie angesichts solcher<br />
Vorlagen noch sinnvoll ist.“ 12<br />
Zwei Thesen stehen sich gegenüber. Die eine, von Duverger vertreten, besagt,<br />
dass nicht nur die Kompliziertheit der politischen Sachfragen zunimmt, sondern<br />
auch das Bildungsniveau der Bevölkerung. Diese vermöge mit der Komplizierung<br />
der Politik intellektuell durchaus Schritt zu halten. 13 Die andere These, im bereits<br />
zitierten Ersten Drorschen Gesetz angedeutet, postuliert eine exponentielle Kurve für<br />
das Anwachsen der Komplexität, während die Fähigkeit, mit Komplexität fertig zu<br />
werden, nur linear zunehme. 14 In der Schweiz ist man geneigt, der pessimistischeren<br />
These beizupflichten. Die politische Bildung der Bevölkerung wurde vernachlässigt,<br />
<strong>und</strong> den Rückstand aufzuholen, dürfte nicht einfach sein. Wachsende Komplexität<br />
politischer Themen stammt zudem in der Schweiz nicht nur „von der Sache<br />
her“, sondern sie wird durch institutionelle Gegebenheiten sozusagen „künstlich“<br />
noch zusätzlich gefördert. Die teilweise verworrene Kompetenzabgrenzung zwischen<br />
Verwaltungsabteilungen <strong>und</strong> Stufen des Gemeinwesens, die extreme Heterogenität<br />
von Gemeinden <strong>und</strong> Kantonen, die durch das „Kollegialitätsprinzip“ erschwerte<br />
Koordination sind geeignet, ohnehin komplizierte Probleme noch komplizierter<br />
zu machen. Die Institution des fakultativen Referendums selbst ist ein Komplizierungsfaktor.<br />
Das Erfordernis, „referendumssichere“ Kompromissformeln zu<br />
finden, führt zu gänzlich neuen Gesichtspunkten bei der Ausarbeitung von Vorlagen<br />
<strong>und</strong> ist kaum dazu angetan, die Dinge durchsichtiger zu gestalten.<br />
(4) Die Zahl der jährlich verabschiedeten B<strong>und</strong>esgesetze ist beträchtlich angestiegen,<br />
während die Zahl der Referendumsabstimmungen nicht über einen bestimmten<br />
Saturationspunkt erhöht werden kann. Diese Tatsache allein schon belegt,<br />
dass die Chance eines Gesetzes, tatsächlich einem Referendum unterworfen<br />
zu werden, abgenommen hat. 14a Die Untersuchung von Neidhart hat überdies ergeben,<br />
dass in neuester Zeit wirklich wichtige Gesetze kaum mehr eine Chance haben,<br />
dem Referendum unterstellt zu werden. Nach der Feststellung dieses Autors<br />
ist seit dem Beginn der fünfziger Jahre „ausnahmslos keines der grossen Gesetzeswerke<br />
mehr in den Volksentscheid gelangt“. 15 Neidhart<br />
12 Schindler, op. cit., S. 120 f.<br />
13 Duverger, Sociologie (op. cit.), S. 95. 14 Siehe oben S. 132.<br />
14a Von 1961 bis 1970 wurden insgesamt 216 Erlasse verabschiedet, die dem fakultativen Referendum<br />
unterlagen. Nur über 7 wurde ein Volksentscheid eingeholt. „Überdies handelte es sich fast ausschliesslich<br />
um Fälle von untergeordneter Bedeutung -sozusagen um ‘Pannen der Konkordanz“‘, (NZZ,<br />
Nr. 85, 21.2.73, S. 191. – Hatte das Volk im verflossenen Jahrzehnt also nur zu 3,2 % der referendumspflichtigen<br />
B<strong>und</strong>esgesetze <strong>und</strong> -beschlüsse etwas zu sagen, so lag dieser Prozentsatz vor der<br />
Jahrh<strong>und</strong>ertwende bedeutend höher, wohl ungefähr bei 20 % (Neidhart, Plebiszit, op. cit., S. 18).<br />
15 Neidhart, Plebiszit (op. cit.), S. 268. Siehe auch: Roland Ruffieux, „Problemes de la democratie directe“,<br />
Civitas, Oktober 1973, S. 29.