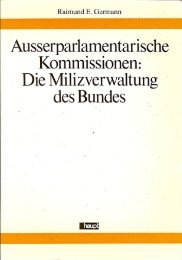Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
33<br />
ten „ warnte der Berner Staatsrechtslehrer Richard Bau ml in, selbst nicht Mitglied<br />
der Wahlen-Kommission, vor dem „Alternativen-Denken“ <strong>und</strong> empfahl bei den Revisionsarbeiten<br />
„die Pflege des staatsrechtlichen Details“. 50 Dabei hat er nicht nur seine<br />
eigene Einstellung zum Revisionsunternehmen, sondern auch die Mentalität seiner<br />
juristischen Kollegen in der Wahlen-Kommission dargestellt. In ihrem Schlussbericht<br />
polemisierte die Kommission gegen die Vorstellung, dass die Totalrevision<br />
einer „tragenden Idee“ bedürfe. 51 Ausdrücklich bekannte sie sich zur „staatsrechtlichen<br />
Detailpflege“, zur Betrachtung von isolierten Einzelproblemen:<br />
„Es hätte einen grossen <strong>und</strong> zeitraubenden Umweg bedeutet; zunächst ein Gesamtbild<br />
des gegenwärtigen Staates mit seinem Verfassungsrecht zu entwerfen<br />
<strong>und</strong> zu vergleichen mit einigen möglichen Entwürfen für eine neue Verfassung.<br />
Man muss <strong>und</strong> darf sich im gegenwärtigen Stadium der Revisionsdiskussion<br />
vielmehr so zurechtfinden, dass die wichtigsten Institutionen einer Verfassung in<br />
Frage gezogen <strong>und</strong> ihre Neuerungsmöglichkeiten diskutiert werden, worauf von<br />
den daraus gewonnenen Einsichten die prinzipiellen Entscheidungen gefällt<br />
werden können.“ 52<br />
2. Der Fragenkatalog <strong>und</strong> die Antworten<br />
Im vorangehenden Kapitel wurde der Fragenkatalog der Wahlen-Kommission daraufhin<br />
untersucht, wie er das Zielproblem behandelt. In diesem Kapitel sollen weitere<br />
Aspekte des Fragenkatalogs untersucht werden, die einen Ein-fluss auf <strong>Innovation</strong>schancen<br />
in dem uns interessierenden Bereich haben könnten. Vorerst gelangen<br />
die im Katalog vorgenommene Themabegrenzung <strong>und</strong> die Themaparzellierung in<br />
den Blickpunkt. Doch sind in diesem Kapitel nun auch die Reaktionen der Befragten<br />
auf den Fragenkatalog in die Untersuchung einzubezieheh. Dabei ist zu prüfen, in<br />
welchem Masse das Fragenschema der Wahlen-Kommission determinierend auf<br />
die Problembehandlung der antwortenden Instanzen wirkte. Zwar betonte die Wahlen-Kommission<br />
im Begleitschreiben zum Fragenkatalog ausdrücklich, dass das<br />
Fragenschema weder Anspruch auf Vollständigkeit erhebe noch als bindende Wegleitung<br />
für die Tätigkeit der verschiedenen zur Mitarbeit eingeladenen Institutionen<br />
<strong>und</strong> Gruppen gedacht sei. Die meisten Vernehmlassungen hielten sich jedoch, wie<br />
noch aufzuzeigen sein wird, getreulich an das Wahlen-Schema. Dies kann kaum<br />
überraschen: Die meisten Arbeitsgruppen der befragten Instanzen befanden sich<br />
unter einem Zeitdruck, der die Schaffung einer eigenen Konzeption der Themabearbeitung<br />
ausschloss. Mehreren Arbeitsgruppen fehlte auch ein gewisses Engagement<br />
für das Revisionsproblem, <strong>und</strong> die strikte Respektierung des Fragenkatalogs<br />
erschien als der Weg des geringsten Widerstandes zur Erledigung des<br />
Auftrags. Personelle Gründe mögen einzelne Arbeitsgruppen ausserstande gesetzt<br />
haben, eine eigene Problembehandlungskonzeption zu erarbeiten. Bei den meisten<br />
Gruppen, die sich an das Fragenschema der Wahlen-Kommission<br />
50 Richard Bäumlin, „Was lässt sich von einer Totalrevision erwarten“, in: Totalrevision der B<strong>und</strong>esverfassung<br />
– Ja oder Nein (op. cit.), S. 15 f.<br />
51 SB S. 39 ff.<br />
52 SB S. 42.