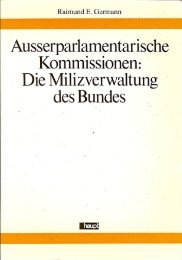Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
92<br />
„. . . le trait caractéristique de l’aspect formel de la participation des cantons au<br />
processus de révision totale est le conservatisme. Devant cette nouvelle tâche<br />
qui demandait un esprit nouveau et qui devait ouvrir de larges possibilités de<br />
dialogue – c’est dans cette optique que s’est faite la propagande de la presse<br />
active – on a ressorti les vieilles Solutions: le personnel politique, administratif<br />
et juridique traditionel, la prudence traditionnelle dans le choix des personnes et<br />
le manque d’imagination dans les méthodes de travail.“ 44<br />
Der Verzicht auf Verfahrensrichtlinien verlieh der Revisionsdebatte die Tendenz,<br />
zum internen Familiengespräch der „politischen Kasse“ zu werden.<br />
6. Die Auswertung der Vernehmlassungen<br />
a) Schwierigkeit der Auswertung<br />
Die Fragetechnik der Wahlen-Kommission, die Umgrenzung des Adressatenkreises<br />
sowie der Verzicht auf Richtlinien für die Fragenbeantwortung bewirkte, dass ein<br />
ausserordentlich heterogenes Antwortenmaterial einging <strong>und</strong> dass die Vernehmlassungen<br />
ein sehr unterschiedliches politisches Gewicht erhielten. Die Eingabe<br />
einer Partei mit Doppelsitz im B<strong>und</strong>esrat ist anders zu gewichten als jene einer<br />
Kleinpartei, die kaum Fraktionsstärke erreicht. Ähnliches ist zu sagen von Kantonen,<br />
deren Bevölkerungszahl stark auseinanderklafft, oder von Verbänden mit sehr<br />
unterschiedlichem Machtpotential. Die Eingabe von Appenzell-Innerrhoden, die von<br />
einer Person erstellt wurde, müsste anders gewichtet werden als jene von Uri, auf<br />
die mehrere H<strong>und</strong>ert Leute Einfluss nehmen konnten. Den minimalistischen Vernehmlassungen<br />
von Ob- <strong>und</strong> Nidwaiden gebührt ein anderes Echo als den vertieften<br />
Erörterungen von Zug, Solothurn <strong>und</strong> St. Gallen. Auch die Universitätsvernehmlassungen<br />
dürfen einander nicht ohne weiteres gleichgestellt werden; während<br />
die Kommission der Universität Genf ganze vier St<strong>und</strong>en tagte, veranstaltete<br />
die Hochschule St. Gallen r<strong>und</strong> 45 Seminarsitzungen. Auch die Form, in denen sich<br />
die Eingaben präsentieren, vermindert ihre Vergleichbarkeit. Während die meisten<br />
antwortenden Instanzen in sich geschlossene <strong>und</strong> tendenziell widerspruchsfreie<br />
Texte ablieferten, reichten andere lediglich die Ergebnisse ihrer verschiedenen<br />
Subkommissionen ein, ohne mögliche Widersprüche zwischen den Gruppen zu<br />
bereinigen (z. B. Universität Zürich, Hochschule St. Gallen). Einzelne Stellungnahmen<br />
von Kantonskommissionen wurden von den betreffenden Kantonsregierungen<br />
desavouiert, während andere Regierungen auf eine eigene Stellungnahme<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich verzichteten. Nur in einem Teil der Eingaben befinden sich<br />
Angaben über das Stimmenverhältnis in der Kommission zu einzelnen Punkten.<br />
Bereits fand Erwähnung, dass die einzelnen Vorschläge von den verschiedenen<br />
Kommissionen mit äusserst unterschiedlichem Engagement vorgetragen wurden.<br />
Offenbar wegen der Heterogenität der Antworten unternahm die Wahlen-<br />
Kommission keinen Versuch zu einer systematischen, interpersonal überprüfbaren<br />
Auswertung der Vernehmlassungen. Vielmehr entschloss sie sich, die Ein-<br />
44 Delley, op. cit, S. 37.