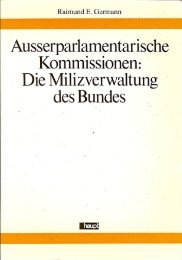Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
174<br />
theoretischen Überlegungen vermag jedoch die Reformtauglichkeit der Kanzleraufwertung<br />
in Zweifel zu ziehen. 9<br />
(1) Ausdrücklich hob der Huber-Bericht hervor, dass ein Stabsorgan von der Leitung<br />
abhängig sein müsse. 10 Der B<strong>und</strong>espräsident <strong>und</strong> das Regierungskollegium<br />
verfügen jedoch über keine nennenswerten Mittel, um ihren „Stabschef“, den Kanzler,<br />
in Abhängigkeit zu halten. Im Gegenteil, bei der Kanzlei scheinen sämtliche<br />
Voraussetzungen erfüllt zu sein, dass sie sich vom Leitungsorgan unabhängig machen<br />
kann. Vorerst ist zu erwähnen, dass der Kanzler nicht etwa vom Leitungsorgan,<br />
sondern vom Parlament gewählt wird. Er kann sich also stets auf die gleiche<br />
Legitimierungsbasis wie die Regierung selbst berufen, nämlich die Parlamentswahl.<br />
Eine Vertrauenskrise zwischen Kanzler <strong>und</strong> Regierungsmitgliedern kann gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
nicht behoben werden, da alle praktisch auf Lebenszeit gewählt sind. – Die<br />
Kanzlei weist des weitern eine monokratische Struktur auf, während die Regierung<br />
ein parteipolitisch sehr heterogen zusammengesetztes Kollegialorgan ist. Überdies<br />
besitzt das Regierungskollegium eine geringere personelle Stabilität als die Kanzlei;<br />
wegen Rücktritten findet alle paar Jahre im B<strong>und</strong>esrat ein Wechsel statt, der Kanzler<br />
dagegen kann im Extremfall jahrzehntelang im Amt verbleiben. – Der nach Anciennitätsregel<br />
jährlich wechselnde B<strong>und</strong>espräsident hat ohnehin keine Chance,<br />
den Kanzler in Abhängigkeit zu halten.<br />
(2) Betrachtet man den umfassenden Kompetenzkatalog der Kanzlei, ihre monokratische<br />
Struktur <strong>und</strong> ihre überlegene Stabilität, so könnte man argumentieren, dass<br />
das Kollegialitätsprinzip durch die Hongler-Reform de facto abgeschafft wurde: Ein<br />
entschlossener Kanzler vermag bei dieser Konstellation die eigentliche Regierungsfunktion<br />
an sich zu ziehen. Dieses Szenarium ist indessen höchst unrealistisch.<br />
Wenn man auch das Machtpotential der einzelnen B<strong>und</strong>esräte nicht sehr hoch<br />
veranschlagen darf, so verfügen diese doch über genügend Ressourcen, um sich<br />
einer „Bevorm<strong>und</strong>ung“ durch den Kanzler zu entziehen. Der Gr<strong>und</strong>reflex jedes<br />
B<strong>und</strong>esrates, seinen departementalen Besitzstand gegenüber den Regierungskollegen<br />
abzusichern, muss sich zwangsläufig auch gegenüber dem Kanzler auswirken.<br />
Das Resultat der Reform dürfte also ein „aufgewerteter“, aber isolierter Kanzler<br />
sein. – Zu bedenken wäre ein Szenarium, wonach die Hongler-Reform nur Episode<br />
bliebe <strong>und</strong> der Kanzler nach einer Übergangsperiode wieder auf seine frühere<br />
Kanzlistenstellung zurückgestuft würde. Auch diese Entwicklung scheint nicht<br />
wahrscheinlich zu sein. Dem Kanzler sollen neue Verwaltungsabteilungen unterstellt<br />
werden (Finanzkontrolle, Amt für Organisation). Zudem wird er in Kanzleiangelegenheiten<br />
vor dem Parlament selbst auftreten <strong>und</strong> in der Regierung Anträge<br />
einbringen können. Als Informationschef der Regierung hat er in der Öffentlichkeit<br />
erhöhte Visibilität erhalten. Diese Umstände dürften der „Aufwertung“ irreversiblen<br />
Charakter verleihen. Hinsichtlich Prestige erscheint der Kanzler –<br />
9 Zur Kanzleireform siehe auch: Germann, B<strong>und</strong>esverwaltung (op. cit.), S. 65 f., 71 ff., 89 ff.; sowie<br />
derselbe, „‘Richtlinien der Regierungspolitik’ – Fragen zu einer neuen Institution“, Verwaltungs-Praxis,<br />
März 1973, S. 71–76; derselbe, „Steckt unsere Regierung in einer Krise“, Tages-Anzeiger, 7.9.74, S.<br />
47 f.<br />
10 Huber-Bericht, S. 29.