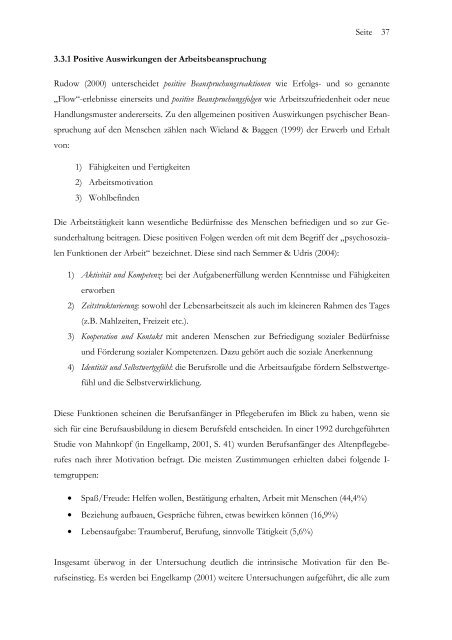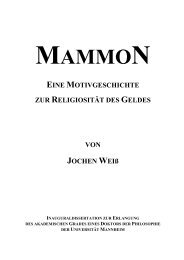- Seite 1 und 2:
Systemisch-lösungsorientierte Bera
- Seite 3 und 4: Danksagung Seite Diese Arbeit ist n
- Seite 5 und 6: Inhaltsverzeichnis Seite DANKSAGUNG
- Seite 7 und 8: Seite 3.3.3.3 Ambulante Pflege ....
- Seite 9 und 10: Seite VII 8.3.1 Zufriedenheitsebene
- Seite 11 und 12: Seite 10.1.2 Ressourcenebene.......
- Seite 13 und 14: Seite Abb. 19: Boxplot der Werte f
- Seite 15 und 16: Seite XIII Tab. 19: Gegenüberstell
- Seite 17 und 18: f Effektstärkemaß (für Mittelwer
- Seite 19 und 20: TEIL I: EINFÜHRUNG Seite 1
- Seite 21 und 22: Seite dingungen in Pflegeberufen in
- Seite 23 und 24: Seite Als drittes und letztes Teilz
- Seite 25 und 26: Seite handensein empirischer Wirksa
- Seite 27 und 28: Seite siert und Anregungen für wei
- Seite 29 und 30: TEIL II: THEORIE Seite 11
- Seite 31 und 32: Seite 10075 „Ergonomische Grundla
- Seite 33 und 34: Seite objektive Situationsmerkmale.
- Seite 35 und 36: Seite interne Kontrollüberzeugunge
- Seite 37 und 38: 1. Tätigkeitserfordernisse und Qua
- Seite 39 und 40: 2.2.4 Zusammenfassung Seite Allgeme
- Seite 41 und 42: Seite Insgesamt waren die Belastung
- Seite 43 und 44: Seite chen Bedürfnisse der zu Pfle
- Seite 45 und 46: Seite organisationale (z.B. Schicht
- Seite 47 und 48: 3. Psychische Beanspruchung, Stress
- Seite 49 und 50: Seite setzungen des Arbeitstätigen
- Seite 51 und 52: Seite als solche abgefragt werden (
- Seite 53: Seite nahmen ableiten lassen. Eine
- Seite 57 und 58: Seite Hier zeigten sich leicht erh
- Seite 59 und 60: 3.3.3 Empirische Studien zu den Fol
- Seite 61 und 62: 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -
- Seite 63 und 64: 3.4 Burnout in der Pflege alter und
- Seite 65 und 66: Seite Zur Messung des Burnouts entw
- Seite 67 und 68: 3.5 Fazit zum Gesundheitszustand in
- Seite 69 und 70: Seite teraktion zwischen Moderatorv
- Seite 71 und 72: Seite wie z.B. die wahrgenommene Ko
- Seite 73 und 74: Seite sich dann eben nicht um sozia
- Seite 75 und 76: Seite Ist die proaktive Einstellung
- Seite 77 und 78: Seite Die Arbeits- und Organisation
- Seite 79 und 80: Seite grenzung ist bisher nicht gel
- Seite 81 und 82: Seite externen Arbeitsbedingungen,
- Seite 83 und 84: Seite impliziert werden. Nach Semme
- Seite 85 und 86: 1) Entspannungstraining 2) Probleml
- Seite 87 und 88: Seite nungsfertigkeit oder Selbstve
- Seite 89 und 90: ) Soziales Kompetenztraining c) Psy
- Seite 91 und 92: Seite he Anforderungen alleine nich
- Seite 93 und 94: Seite 5. Systemisch-lösungsorienti
- Seite 95 und 96: 5.2 Theoretische Grundlagen der sys
- Seite 97 und 98: Seite kann (z.B. Bamberger, 2001).
- Seite 99 und 100: 5) Kontextbezogenheit Seite Ein wei
- Seite 101 und 102: Kontaktphase/Beginn der Beratung Se
- Seite 103 und 104: Hypothetische Lösungen Seite Falls
- Seite 105 und 106:
Seite 5.5 Eignung der systemisch-l
- Seite 107 und 108:
Seite stimmten Kontext sehr belaste
- Seite 109 und 110:
Seite 6. Arbeitsmodell zur ressourc
- Seite 111 und 112:
Seite Das Curriculum wurde nach den
- Seite 113 und 114:
A) Beratungskompetenz Seite Das Hau
- Seite 115 und 116:
Seite und prozedurale Wissen, die a
- Seite 117 und 118:
Seite stellung sowie die interperso
- Seite 119 und 120:
7. Beschreibung des Kurses „Einf
- Seite 121 und 122:
• Begrüßung der Teilnehmer und
- Seite 123 und 124:
7.3 Die innere Struktur der Trainin
- Seite 125 und 126:
Seite 107 eignet sich auch für ein
- Seite 127 und 128:
• Kontaktphase und kurze Problemb
- Seite 129 und 130:
Seite 111 der Tatsache, dass die Be
- Seite 131 und 132:
Seite 113 kontrollgruppe installier
- Seite 133 und 134:
8.3 Forschungsinstrumente Seite 115
- Seite 135 und 136:
Seite 117 mischen Beratern konstrui
- Seite 137 und 138:
8.3.2.2 Rollenspiele Seite 119 Das
- Seite 139 und 140:
1. Problemanalyse/Defizitorientieru
- Seite 141 und 142:
Seite 123 Die Faktoren alternatives
- Seite 143 und 144:
Seite 125 nahme eines Kontinuums mi
- Seite 145 und 146:
Seite 127 Bedrohung oder als Verlus
- Seite 147 und 148:
Seite 129 • Beispielitem zur Übe
- Seite 149 und 150:
Anmeldungen zum Kurs Seite 131 Tab.
- Seite 151 und 152:
8.6 Auswertung der Daten Seite 133
- Seite 153 und 154:
8.8 Prüfung der teststatistischen
- Seite 155 und 156:
8.8.4 Subjektive Zufriedenheits-Dat
- Seite 157 und 158:
Zufriedenheit mit… …den Kursinh
- Seite 159 und 160:
Seite 141 mender Anzahl der Beobach
- Seite 161 und 162:
Seite 143 Bei allen drei Variablen
- Seite 163 und 164:
Unterschiede u. Ausnahmen N Mittelw
- Seite 165 und 166:
Seite 147 Auch hier fällt sofort e
- Seite 167 und 168:
Seite 149 Tab. 10 und Abb. 21 zeige
- Seite 169 und 170:
Seite 151 Rollenspiel ein Minimum a
- Seite 171 und 172:
9.2.1.5 Subjektive Beurteilung durc
- Seite 173 und 174:
Zufriedenheit mit Beratung 4,0 3,5
- Seite 175 und 176:
Seite 157 den Wilcoxon-Test). Der b
- Seite 177 und 178:
N Mittelwert Median Standardabweich
- Seite 179 und 180:
Ergebnis Prätest Ergebnis Posttest
- Seite 181 und 182:
Punkt im Wissenstest 90 80 70 60 50
- Seite 183 und 184:
Selbstwirksamkeit Selbstwirksamkeit
- Seite 185 und 186:
9.2.3.2 Bedrohungseinschätzungen B
- Seite 187 und 188:
Bedrohungseinschätzung Bedrohungse
- Seite 189 und 190:
Seite 171 Nach dem Kurs zeigte sich
- Seite 191 und 192:
Interaktion/Kommunikation 9.3.2 Ver
- Seite 193 und 194:
9.3.4 Subjektiv eingeschätzter ges
- Seite 195 und 196:
Selbstwirksamkeit Abb. 41: Grafisch
- Seite 197 und 198:
Proaktive ProaktiveEinstellung Eins
- Seite 199 und 200:
TEIL IV: ZUSAMMENFASSUNG UND DISKUS
- Seite 201 und 202:
Seite 183 Aussagekraft der Effektiv
- Seite 203 und 204:
Seite 185 zu kommunizieren sowie ei
- Seite 205 und 206:
Seite 187 aber wegen der geringen G
- Seite 207 und 208:
Mit 1. verbanden sich drei untergeo
- Seite 209 und 210:
• Kompensatorische Maßnahmen fü
- Seite 211 und 212:
Seite 193 des Treatments ist jedoch
- Seite 213 und 214:
Seite 195 Im Hinblick auf die Errei
- Seite 215 und 216:
TEIL V: LITERATURVERZEICHNIS Seite
- Seite 217 und 218:
Seite 199 Berger, J. & Nolting, H.-
- Seite 219 und 220:
Seite 201 DIN. (2000). DIN EN ISO 1
- Seite 221 und 222:
Seite 203 Hofmann, F. & Michaelis,
- Seite 223 und 224:
Seite 205 Meichenbaum, D. (2003). I
- Seite 225 und 226:
Seite 207 Segerstrom, S. C., Taylor
- Seite 227 und 228:
TEIL VI: ANHÄNGE Seite 209
- Seite 229 und 230:
ANHANG B. WISSENSTEST PRÄ Wissens-
- Seite 231 und 232:
ANHANG D. RATINGBOGEN FÜR DAS RATI
- Seite 233 und 234:
6. Der Berater hat meine bisherigen
- Seite 235 und 236:
9. Mein Leben wird vor allem durch
- Seite 237 und 238:
5. Die Zusammenarbeit mit Schülern
- Seite 239 und 240:
(Auftrag kann man sich nur selbst g
- Seite 241 und 242:
Zeit selbst einteilen kann. Wenig E
- Seite 243 und 244:
T h e o r i e Systemisch-Lösungsor
- Seite 245 und 246:
Ursachenorientierte Fragen (vergang
- Seite 247 und 248:
Besprechen der Hausaufgabe Training
- Seite 249 und 250:
Phasenmodell vorstellen und austeil
- Seite 251 und 252:
Lösungsorientierte Interventionen:
- Seite 253 und 254:
Wichtige Fragen zur Auftragsklärun
- Seite 255 und 256:
lösungsorientierte Beratung geht d
- Seite 257 und 258:
• Wie würde Ihr Mann/Ihre Frau a
- Seite 259 und 260:
Übung zu Veränderungen vor der Be
- Seite 261 und 262:
c) Was wäre wenn? (Hypothetische L
- Seite 263 und 264:
• Z.B. Münzwurf bei Liebeskummer
- Seite 265 und 266:
Rückfallprophylaxe: evtl. Bild mit