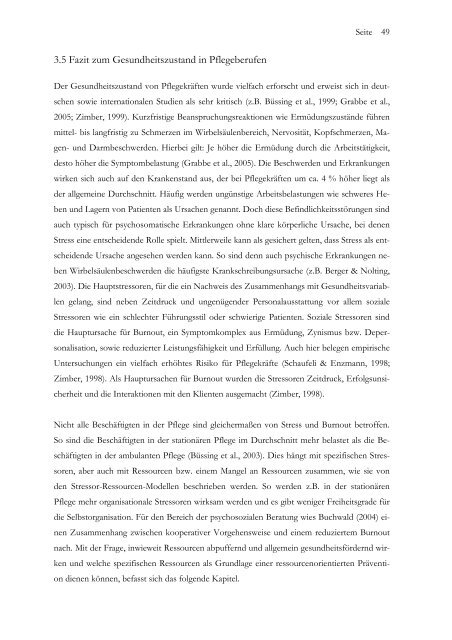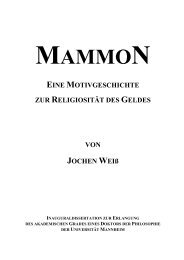Dissertation Abel - MADOC - Universität Mannheim
Dissertation Abel - MADOC - Universität Mannheim
Dissertation Abel - MADOC - Universität Mannheim
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
3.5 Fazit zum Gesundheitszustand in Pflegeberufen<br />
Seite<br />
Der Gesundheitszustand von Pflegekräften wurde vielfach erforscht und erweist sich in deut-<br />
schen sowie internationalen Studien als sehr kritisch (z.B. Büssing et al., 1999; Grabbe et al.,<br />
2005; Zimber, 1999). Kurzfristige Beanspruchungsreaktionen wie Ermüdungszustände führen<br />
mittel- bis langfristig zu Schmerzen im Wirbelsäulenbereich, Nervosität, Kopfschmerzen, Ma-<br />
gen- und Darmbeschwerden. Hierbei gilt: Je höher die Ermüdung durch die Arbeitstätigkeit,<br />
desto höher die Symptombelastung (Grabbe et al., 2005). Die Beschwerden und Erkrankungen<br />
wirken sich auch auf den Krankenstand aus, der bei Pflegekräften um ca. 4 % höher liegt als<br />
der allgemeine Durchschnitt. Häufig werden ungünstige Arbeitsbelastungen wie schweres He-<br />
ben und Lagern von Patienten als Ursachen genannt. Doch diese Befindlichkeitsstörungen sind<br />
auch typisch für psychosomatische Erkrankungen ohne klare körperliche Ursache, bei denen<br />
Stress eine entscheidende Rolle spielt. Mittlerweile kann als gesichert gelten, dass Stress als ent-<br />
scheidende Ursache angesehen werden kann. So sind denn auch psychische Erkrankungen ne-<br />
ben Wirbelsäulenbeschwerden die häufigste Krankschreibungsursache (z.B. Berger & Nolting,<br />
2003). Die Hauptstressoren, für die ein Nachweis des Zusammenhangs mit Gesundheitsvariab-<br />
len gelang, sind neben Zeitdruck und ungenügender Personalausstattung vor allem soziale<br />
Stressoren wie ein schlechter Führungsstil oder schwierige Patienten. Soziale Stressoren sind<br />
die Hauptursache für Burnout, ein Symptomkomplex aus Ermüdung, Zynismus bzw. Deper-<br />
sonalisation, sowie reduzierter Leistungsfähigkeit und Erfüllung. Auch hier belegen empirische<br />
Untersuchungen ein vielfach erhöhtes Risiko für Pflegekräfte (Schaufeli & Enzmann, 1998;<br />
Zimber, 1998). Als Hauptursachen für Burnout wurden die Stressoren Zeitdruck, Erfolgsunsi-<br />
cherheit und die Interaktionen mit den Klienten ausgemacht (Zimber, 1998).<br />
Nicht alle Beschäftigten in der Pflege sind gleichermaßen von Stress und Burnout betroffen.<br />
So sind die Beschäftigten in der stationären Pflege im Durchschnitt mehr belastet als die Be-<br />
schäftigten in der ambulanten Pflege (Büssing et al., 2003). Dies hängt mit spezifischen Stres-<br />
soren, aber auch mit Ressourcen bzw. einem Mangel an Ressourcen zusammen, wie sie von<br />
den Stressor-Ressourcen-Modellen beschrieben werden. So werden z.B. in der stationären<br />
Pflege mehr organisationale Stressoren wirksam werden und es gibt weniger Freiheitsgrade für<br />
die Selbstorganisation. Für den Bereich der psychosozialen Beratung wies Buchwald (2004) ei-<br />
nen Zusammenhang zwischen kooperativer Vorgehensweise und einem reduziertem Burnout<br />
nach. Mit der Frage, inwieweit Ressourcen abpuffernd und allgemein gesundheitsfördernd wir-<br />
ken und welche spezifischen Ressourcen als Grundlage einer ressourcenorientierten Präventi-<br />
on dienen können, befasst sich das folgende Kapitel.<br />
49