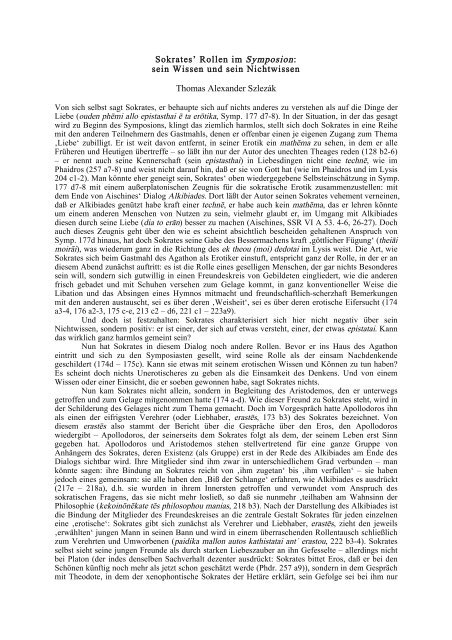Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Sokrates’ Rollen im Symposion:<br />
sein Wissen und sein Nichtwissen<br />
Thomas Alexander Szlezák<br />
Von sich selbst sagt Sokrates, er behaupte sich auf nichts anderes zu verstehen als auf die Dinge der<br />
Liebe (ouden phēmi allo epistasthai ē ta erōtika, Symp. 177 d7-8). In der Situation, in der das gesagt<br />
wird zu Beginn des Symposions, klingt das ziemlich harmlos, stellt sich doch Sokrates in eine Reihe<br />
mit den anderen Teilnehmern des Gastmahls, denen er offenbar einen je eigenen Zugang zum Thema<br />
‚Liebe‘ zubilligt. Er ist weit davon entfernt, in seiner Erotik ein mathēma zu sehen, in dem er alle<br />
Früheren und Heutigen übertreffe – so läßt ihn nur der Autor des unechten Theages reden (128 b2-6)<br />
– er nennt auch seine Kennerschaft (sein epistasthai) in Liebesdingen nicht eine technē, wie im<br />
Phaidros (257 a7-8) und weist nicht darauf hin, daß er sie von Gott hat (wie im Phaidros und im Lysis<br />
204 c1-2). Man könnte eher geneigt sein, Sokrates‘ oben wiedergegebene Selbsteinschätzung in Symp.<br />
177 d7-8 mit einem außerplatonischen Zeugnis für die sokratische Erotik zusammenzustellen: mit<br />
dem Ende von Aischines‘ Dialog Alkibiades. Dort läßt der Autor seinen Sokrates vehement verneinen,<br />
daß er Alkibiades genützt habe kraft einer technē, er habe auch kein mathēma, das er lehren könnte<br />
um einem anderen Menschen von Nutzen zu sein, vielmehr glaubt er, im Umgang mit Alkibiades<br />
diesen durch seine Liebe (dia to erān) besser zu machen (Aischines, SSR VI A 53. 4-6, 26-27). Doch<br />
auch dieses Zeugnis geht über den wie es scheint absichtlich bescheiden gehaltenen Anspruch von<br />
Symp. 177d hinaus, hat doch Sokrates seine Gabe des Bessermachens kraft ‚göttlicher Fügung‘ (theiāi<br />
moirāi), was wiederum ganz in die Richtung des ek theou (moi) dedotai im Lysis weist. Die Art, wie<br />
Sokrates sich beim Gastmahl des Agathon als Erotiker einstuft, entspricht ganz der Rolle, in der er an<br />
diesem Abend zunächst auftritt: es ist die Rolle eines geselligen Menschen, der gar nichts Besonderes<br />
sein will, sondern sich gutwillig in einen Freundeskreis von Gebildeten eingliedert, wie die anderen<br />
frisch gebadet und mit Schuhen versehen zum Gelage kommt, in ganz konventioneller Weise die<br />
Libation und das Absingen eines Hymnos mitmacht und freundschaftlich-scherzhaft Bemerkungen<br />
mit den anderen austauscht, sei es über deren ‚Weisheit‘, sei es über deren erotische Eifersucht (174<br />
a3-4, 176 a2-3, 175 c-e, 213 c2 – d6, 221 c1 – 223a9).<br />
Und doch ist festzuhalten: Sokrates charakterisiert sich hier nicht negativ über sein<br />
Nichtwissen, sondern positiv: er ist einer, der sich auf etwas versteht, einer, der etwas epistatai. Kann<br />
das wirklich ganz harmlos gemeint sein?<br />
Nun hat Sokrates in diesem Dialog noch andere Rollen. Bevor er ins Haus des Agathon<br />
eintritt und sich zu den Symposiasten gesellt, wird seine Rolle als der einsam Nachdenkende<br />
geschildert (174d – 175c). Kann sie etwas mit seinem erotischen Wissen und Können zu tun haben?<br />
Es scheint doch nichts Unerotischeres zu geben als die Einsamkeit des Denkens. Und von einem<br />
Wissen oder einer Einsicht, die er soeben gewonnen habe, sagt Sokrates nichts.<br />
Nun kam Sokrates nicht allein, sondern in Begleitung des Aristodemos, den er unterwegs<br />
getroffen und zum Gelage mitgenommen hatte (174 a-d). Wie dieser Freund zu Sokrates steht, wird in<br />
der Schilderung des Gelages nicht zum Thema gemacht. Doch im Vorgespräch hatte Apollodoros ihn<br />
als einen der eifrigsten Verehrer (oder Liebhaber, erastēs, 173 b3) des Sokrates bezeichnet. Von<br />
diesem erastēs also stammt der Bericht über die Gespräche über den Eros, den Apollodoros<br />
wiedergibt – Apollodoros, der seinerseits dem Sokrates folgt als dem, der seinem Leben erst Sinn<br />
gegeben hat. Apollodoros und Aristodemos stehen stellvertretend für eine ganze Gruppe von<br />
Anhängern des Sokrates, deren Existenz (als Gruppe) erst in der Rede des Alkibiades am Ende des<br />
Dialogs sichtbar wird. Ihre Mitglieder sind ihm zwar in unterschiedlichem Grad verbunden – man<br />
könnte sagen: ihre Bindung an Sokrates reicht von ‚ihm zugetan‘ bis ‚ihm verfallen‘ – sie haben<br />
jedoch eines gemeinsam: sie alle haben den ‚Biß der Schlange‘ erfahren, wie Alkibiades es ausdrückt<br />
(217e – 218a), d.h. sie wurden in ihrem Innersten getroffen und verwundet vom Anspruch des<br />
sokratischen Fragens, das sie nicht mehr losließ, so daß sie nunmehr ‚teilhaben am Wahnsinn der<br />
Philosophie (kekoinōnēkate tēs philosophou manias, 218 b3). Nach der Darstellung des Alkibiades ist<br />
die Bindung der Mitglieder des Freundeskreises an die zentrale Gestalt Sokrates für jeden einzelnen<br />
eine ‚erotische‘: Sokrates gibt sich zunächst als Verehrer und Liebhaber, erastēs, zieht den jeweils<br />
‚erwählten‘ jungen Mann in seinen Bann und wird in einem überraschenden Rollentausch schließlich<br />
zum Verehrten und Umworbenen (paidika mallon autos kathistatai ant´ erastou, 222 b3-4). Sokrates<br />
selbst sieht seine jungen Freunde als durch starken Liebeszauber an ihn Gefesselte – allerdings nicht<br />
bei Platon (der indes denselben Sachverhalt dezenter ausdrückt: Sokrates bittet Eros, daß er bei den<br />
Schönen künftig noch mehr als jetzt schon geschätzt werde (Phdr. 257 a9)), sondern in dem Gespräch<br />
mit Theodote, in dem der xenophontische Sokrates der Hetäre erklärt, sein Gefolge sei bei ihm nur