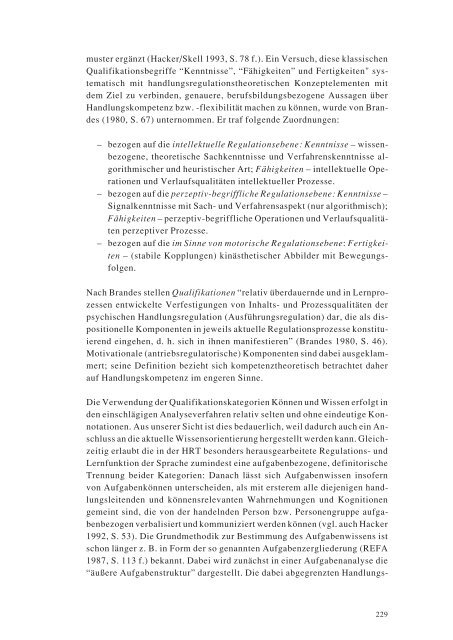- Seite 1 und 2:
QUEM-report Schriften zur beruflich
- Seite 3 und 4:
Zu diesem Heft Das BMBF-Programm
- Seite 5:
Inhaltsverzeichnis Seite Martin Hen
- Seite 8 und 9:
nenbereich durch Qualifikations- un
- Seite 10 und 11:
sich die Autoren zu diesen elementa
- Seite 12 und 13:
1 Hänschen und Hans “Erziehung i
- Seite 14 und 15:
de alle Kenntnisse und Fertigkeiten
- Seite 16 und 17:
häufig zu hören bekamen, und die
- Seite 18 und 19:
Einheit der gesellschaftlichen Phä
- Seite 20 und 21:
che passivische Sinn der Aussage, d
- Seite 22 und 23:
welchen Kriterien bestimmte Ereigni
- Seite 24 und 25:
en Konzeptionen der Fort- und Weite
- Seite 26 und 27:
schen Gleichschaltung. Die Amerika-
- Seite 28 und 29:
schicht-Angeboten der traditionelle
- Seite 30 und 31:
4 Kategorisierungen Im programmatis
- Seite 32 und 33:
und der Notwendigkeit der Versöhnu
- Seite 34 und 35:
zeugen. Gemeint sind damit jene The
- Seite 36 und 37:
Theoretikers sehen, einen Tunnelbli
- Seite 38 und 39:
Legitimation und Verpflichtung der
- Seite 40 und 41:
6 Historische, gesetzliche und rech
- Seite 42 und 43:
germaßen klares Bild über die der
- Seite 44 und 45:
Jahre 1970 einen “Strukturplan”
- Seite 46 und 47:
gie angesprochenen Distanz der Erwa
- Seite 48 und 49:
Inhaltlich ist Knolls Vorstellung n
- Seite 50 und 51:
se an einem flächendeckenden Aufba
- Seite 52 und 53:
7 Exemplarische Theorien Die mit Be
- Seite 54 und 55:
Vagen. Erwachsenenbildung wird zu e
- Seite 56 und 57:
Kenntnisse nur durch systematische
- Seite 58 und 59:
für ihre eigenen Zwecke betreiben.
- Seite 60 und 61:
2. Horizontqualifikationen: Informa
- Seite 62 und 63:
men wäre, ja, ihnen in der Regel n
- Seite 64 und 65:
dung” ist freilich ebenso wichtig
- Seite 66 und 67:
fast sagen, ein Wort des Augustinus
- Seite 68 und 69:
grundlegendem Ansatz, in individuel
- Seite 70 und 71:
funden habe, und versucht, mit Hilf
- Seite 72 und 73:
fachung entsprechender marxscher Ge
- Seite 74 und 75:
der sie sich erwerben kann, und wir
- Seite 76 und 77:
(durch die Einrichtung eines Studie
- Seite 78 und 79:
von der Totalität der bürgerliche
- Seite 80 und 81:
Ideen selbst zur materiellen Gewalt
- Seite 82 und 83:
nach 1968 sogar möglich, in evange
- Seite 84 und 85:
Teile - von denen der eine über ih
- Seite 86 und 87:
dungsveranstaltungen durch fiktive
- Seite 88 und 89:
Hans Tietgens blickte auf die Gesch
- Seite 90 und 91:
Es kann kein Zweifel daran bestehen
- Seite 92 und 93:
Hand. Ja, diese Offenheit in der in
- Seite 94 und 95:
hirn ist kein Computer, der einen I
- Seite 96 und 97:
Literatur Axmacher, D.: Erwachsenen
- Seite 99 und 100:
Astrid Franzke und Michael Franzke
- Seite 101 und 102:
dialektischen Struktur des “Schl
- Seite 103 und 104:
1 Einleitung Die DDR hatte in den 7
- Seite 105 und 106:
Allgemeinbildung darauf orientiert,
- Seite 107 und 108:
in den Tätigkeiten des sozialen Um
- Seite 109 und 110:
gleiche Struktur auf. Bezüglich de
- Seite 111 und 112:
und damit des Menschen selbst, als
- Seite 113 und 114:
3 Zum Verhältnis von Individuum un
- Seite 115 und 116:
tes, neben den Individuen stehendes
- Seite 117 und 118:
viduum immer auch ein Naturwesen, a
- Seite 119 und 120:
3.5 Verhältnis von individuellen u
- Seite 121 und 122:
3.6 Verhältnis von individuellem u
- Seite 123 und 124:
Individuelles und gesellschaftliche
- Seite 125 und 126:
Individualität wurde in Abgrenzung
- Seite 127 und 128:
len Besonderheiten geprägt ist. Ne
- Seite 129 und 130:
einzelne Schüler (vgl. Klein 1974,
- Seite 131 und 132:
4.5 Begabtenförderung Begabtenför
- Seite 133 und 134:
Tabelle 5 Entscheidende Persönlich
- Seite 135 und 136:
Lebensäußerungen der Individuen u
- Seite 137 und 138:
der Persönlichkeitsstruktur von de
- Seite 139 und 140:
Zur allseitigen Entwicklung der Fä
- Seite 141 und 142:
- Bei der Bestimmung von Persönlic
- Seite 143 und 144:
des Begriffs Persönlichkeit auf di
- Seite 145 und 146:
Lernen ist stets vermittelt über s
- Seite 147 und 148:
Tabelle 6 Klassifikation der Lernar
- Seite 149 und 150:
wusstheit waren von diesen inneren
- Seite 151 und 152:
Tabelle 10 Motive, die die Lernakti
- Seite 153 und 154:
Gewinnung verallgemeinerter Sach- u
- Seite 155 und 156:
- das Maß des Verhältnisses von L
- Seite 157 und 158:
Neuner verkündete 1986: “Die Leh
- Seite 159 und 160:
hungen, von denen Erfolg und Misser
- Seite 161 und 162:
Die Wirksamkeit des Lehrers ist ma
- Seite 163 und 164:
7 Umsetzungsimplikationen und -erfa
- Seite 165 und 166:
- Für jedes Fach ist eine genaue F
- Seite 167 und 168:
mit Fragen nach deren ethischen und
- Seite 169 und 170:
Literatur Ahrbeck, R.: Die allseiti
- Seite 171 und 172:
Giesecke, H.: Was wird aus der “s
- Seite 173 und 174:
Klix, F.: Erwachendes Denken. Berli
- Seite 175 und 176:
Mehlhorn, H.-G.: Persönlichkeitsen
- Seite 177 und 178: Elmar Witzgall Aufgabenorientierte
- Seite 179 und 180: Die Dilemmata flexibler Strukturen
- Seite 181 und 182: 2. Transparenz ist wichtig, um das
- Seite 183 und 184: theoretischen Hintergrund reklamier
- Seite 185 und 186: 2 Lehren und Lernen an der Arbeitsa
- Seite 187 und 188: Zweiten Weltkrieg als auch die Rati
- Seite 189 und 190: - Ziele und Vorgaben des Betriebs,
- Seite 191 und 192: Das gesicherte Wissen über den Zus
- Seite 193 und 194: tionellen Wissensmanagements an. In
- Seite 195 und 196: Das Lernstattkonzept hat sich aus s
- Seite 197 und 198: der 80er Jahre ebenfalls am Lernauf
- Seite 199 und 200: dern. Erstere sollten sich zugunste
- Seite 201 und 202: Querverbindungen zwischen Industrie
- Seite 203 und 204: Jahre zurückreichten, eine breit e
- Seite 205 und 206: In den USA waren es vor allem Dewey
- Seite 207 und 208: Weiterentwicklungen dieser Methodol
- Seite 209 und 210: eitshandlungen soll danach exemplar
- Seite 211 und 212: - einer intellektuellen Regulations
- Seite 213 und 214: handlungen (analog dem Interiorisat
- Seite 215 und 216: nellen Werkzeugmaschinen auf solche
- Seite 217 und 218: 10. Die Bearbeitung und Lösung der
- Seite 219 und 220: des Lernerfolgs korrespondiert. In
- Seite 221 und 222: Zu (b): Der aufgabenorientierte Inf
- Seite 223 und 224: net (Krogoll 1998, S. 148 ff.). Dab
- Seite 225 und 226: konstituieren, indem “relativ uni
- Seite 227: zeptiv-begriffliche Regulationseben
- Seite 231 und 232: einem Bearbeitungsvermerk an die ge
- Seite 233 und 234: nisationales Lernen) hervorrufen, i
- Seite 235 und 236: eitshandlungen nur sehr unzureichen
- Seite 237 und 238: Der immer noch viel und vielfältig
- Seite 239 und 240: darin bestehen, dass der Transfer v
- Seite 241 und 242: weltschutz verbinden lassen. Das Au
- Seite 243 und 244: 4.3 Transfer in die Berufsausbildun
- Seite 245 und 246: machten und für den Lernzweck mehr
- Seite 247 und 248: zess-Basisebene an, um sich darauf
- Seite 249 und 250: zur Einarbeitung in eine neue Aufga
- Seite 251 und 252: 5 Aufgabenorientiertes Lernen im Sp
- Seite 253 und 254: · Das Arbeitsprozess-Wissen kann i
- Seite 255 und 256: tigkeitstheorie weiterentwickelt we
- Seite 257 und 258: Brandes, H.: Flexibilität und Qual
- Seite 259 und 260: Frei, F.; Duell, W.; Baitsch, Ch.:
- Seite 261 und 262: Holzkamp, K.: Lernen. Subjektwissen
- Seite 263 und 264: Lexikon der Wirtschaft: Arbeit Bild
- Seite 265 und 266: Schneider, N.: Untersuchungen zur E
- Seite 267 und 268: Volpert, W.: Der Zusammenhang zwisc
- Seite 269 und 270: Heidi Behrens, Paul Ciupke und Norb
- Seite 271 und 272: Dieser Zentralbegriff “Individuum
- Seite 273 und 274: Wenn sich Individualisierung stills
- Seite 275 und 276: Die Essentials neuer Lernkonzepte d
- Seite 277 und 278: - und schließlich eine veränderte
- Seite 279 und 280:
2 Lernkonzepte der 70er und 80er Ja
- Seite 281 und 282:
Erwachsenenbildung ein. Darin (unte
- Seite 283 und 284:
Motivlage Integration im Weiterbild
- Seite 285 und 286:
ildungsinteressen der Subjekte zu b
- Seite 287 und 288:
werden hier doch schon Normalbiogra
- Seite 289 und 290:
gruppen also, sondern besonderen Gr
- Seite 291 und 292:
wissenschaftlich zu kritisieren und
- Seite 293 und 294:
Jahren von der Bildungspolitik eine
- Seite 295 und 296:
gerinitiativen und Neuen sozialen B
- Seite 297 und 298:
praktiziert wurden. Lutz von Werder
- Seite 299 und 300:
stimmen das Bild ebenso wie das Bem
- Seite 301 und 302:
und sozialpolitischen und einer cur
- Seite 303 und 304:
Der weltanschauliche und gesellscha
- Seite 305 und 306:
dung. Analysen des gesellschaftlich
- Seite 307 und 308:
der Seminarwirklichkeit: mit den Bi
- Seite 309 und 310:
3.3 Jugendbildung Im Arbeitsprofil
- Seite 311 und 312:
Lernens zugleich, soziale Bewegunge
- Seite 313 und 314:
lichkeiten) ohne Zensur durch polit
- Seite 315 und 316:
tutionalisierten Bewegungslernen oh
- Seite 317 und 318:
4 Resümee und weiterführende Frag
- Seite 319 und 320:
thetisches Urteil) nicht nur vermit
- Seite 321 und 322:
deren Institutionentypus: Ihn zeich
- Seite 323 und 324:
können” (Hartkemeyer 2001) gehö
- Seite 325 und 326:
Erwachsenenbildung galt im Horizont
- Seite 327 und 328:
Institutionen und Veranstaltungen d
- Seite 329 und 330:
Literatur Achten, U.: Gemeinsam ler
- Seite 331 und 332:
Bergmann, K.; Frank, G. (Hrsg.): Bi
- Seite 333 und 334:
Ciupke, P.; Jelich, F.-J. (Hrsg.):
- Seite 335 und 336:
Giesecke, H.: Die Jugendarbeit. Mü
- Seite 337 und 338:
Kade, J.; Seitter, W.: Lebenslanges
- Seite 339 und 340:
Lecke, D. (Hrsg.): Lebensorte als L
- Seite 341 und 342:
Offe, C.: Politische Herrschaft und
- Seite 343 und 344:
Tietgens, H.: Warum kommen wenig In