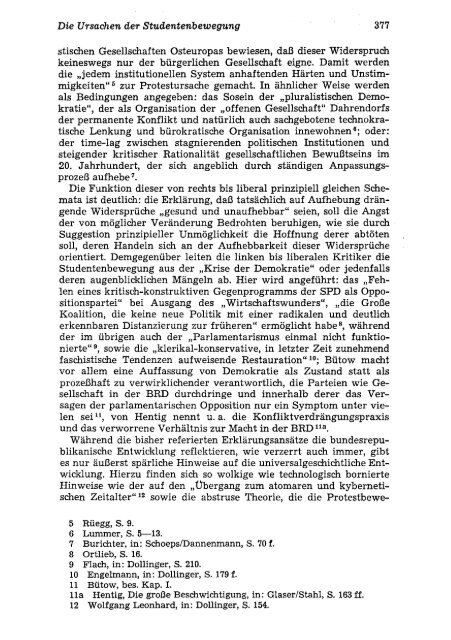Faschismus-Theorien (VI) / Diskussion - Berliner Institut für kritische ...
Faschismus-Theorien (VI) / Diskussion - Berliner Institut für kritische ...
Faschismus-Theorien (VI) / Diskussion - Berliner Institut für kritische ...
- Keine Tags gefunden...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Die Ursachen der Studentenbewegung 377<br />
stischen Gesellschaften Osteuropas bewiesen, daß dieser Widerspruch<br />
keineswegs nur der bürgerlichen Gesellschaft eigne. Damit werden<br />
die „jedem institutionellen System anhaftenden Härten und Unstimmigkeiten"<br />
5 zur Protestursache gemacht. In ähnlicher Weise werden<br />
als Bedingungen angegeben: das Sosein der „pluralistischen Demokratie",<br />
der als Organisation der „offenen Gesellschaft" Dahrendorfs<br />
der permanente Konflikt und natürlich auch sachgebotene technokratische<br />
Lenkung und bürokratische Organisation innewohnen 6 ; oder:<br />
der time-lag zwischen stagnierenden politischen <strong>Institut</strong>ionen und<br />
steigender <strong>kritische</strong>r Rationalität gesellschaftlichen Bewußtseins im<br />
20. Jahrhundert, der sich angeblich durch ständigen Anpassungsprozeß<br />
aufhebe 7 .<br />
Die Funktion dieser von rechts bis liberal prinzipiell gleichen Schemata<br />
ist deutlich: die Erklärung, daß tatsächlich auf Aufhebung drängende<br />
Widersprüche „gesund und unaufhebbar" seien, soll die Angst<br />
der von möglicher Veränderung Bedrohten beruhigen, wie sie durch<br />
Suggestion prinzipieller Unmöglichkeit die Hoffnung derer abtöten<br />
soll, deren Handeln sich an der Aufhebbarkeit dieser Widersprüche<br />
orientiert. Demgegenüber leiten die linken bis liberalen Kritiker die<br />
Studentenbewegung aus der „Krise der Demokratie" oder jedenfalls<br />
deren augenblicklichen Mängeln ab. Hier wird angeführt: das „Fehlen<br />
eines kritisch-konstruktiven Gegenprogramms der SPD als Oppositionspartei"<br />
bei Ausgang des „Wirtschaftswunders", „die Große<br />
Koalition, die keine neue Politik mit einer radikalen und deutlich<br />
erkennbaren Distanzierung zur früheren" ermöglicht habe 8 , während<br />
der im übrigen auch der „Parlamentarismus einmal nicht funktionierte"<br />
9 , sowie die „klerikal-konservative, in letzter Zeit zunehmend<br />
faschistische Tendenzen aufweisende Restauration" 10 ; Bütow macht<br />
vor allem eine Auffassung von Demokratie als Zustand statt als<br />
prozeßhaft zu verwirklichender verantwortlich, die Parteien wie Gesellschaft<br />
in der BRD durchdringe und innerhalb derer das Versagen<br />
der parlamentarischen Opposition nur ein Symptom unter vielen<br />
sei u , von Hentig nennt u. a. die Konfliktverdrängungspraxis<br />
und das verworrene Verhältnis zur Macht in der BRD na .<br />
Während die bisher referierten Erklärungsansätze die bundesrepublikanische<br />
Entwicklung reflektieren, wie verzerrt auch immer, gibt<br />
es nur äußerst spärliche Hinweise auf die universalgeschichtliche Entwicklung.<br />
Hierzu finden sich so wolkige wie technologisch bornierte<br />
Hinweise wie der auf den „Übergang zum atomaren und kybernetischen<br />
Zeitalter" 12 sowie die abstruse Theorie, die die Protestbewe-<br />
5 Rüegg, S. 9.<br />
6 Lummer, S. 5—13.<br />
7 Burichter, in: Schoeps/Dannenmann, S. 70 f.<br />
8 Ortlieb, S. 16.<br />
9 Flach, in: Dollinger, S. 210.<br />
10 Engelmann, in: Dollinger, S. 179 f.<br />
11 Bütow, bes. Kap. I.<br />
IIa Hentig, Die große Beschwichtigung, in: Glaser/Stahl, S. 163 ff.<br />
12 Wolfgang Leonhard, in: Dollinger, S. 154.