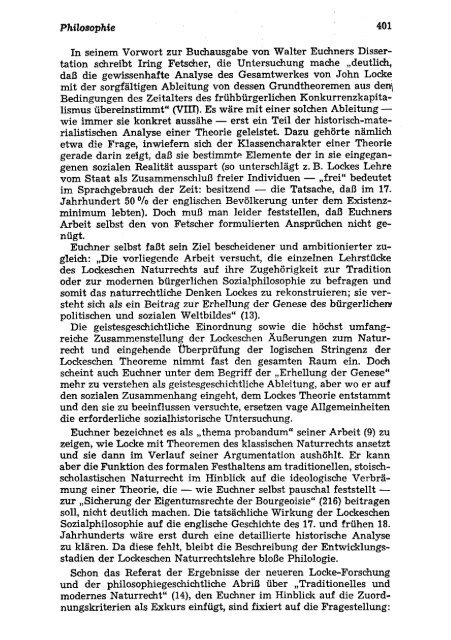Faschismus-Theorien (VI) / Diskussion - Berliner Institut für kritische ...
Faschismus-Theorien (VI) / Diskussion - Berliner Institut für kritische ...
Faschismus-Theorien (VI) / Diskussion - Berliner Institut für kritische ...
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Philosophie 401<br />
In seinem Vorwort zur Buchausgabe von Walter Euchners Dissertation<br />
schreibt Iring Fetscher, die Untersuchung mache „deutlich,<br />
daß die gewissenhafte Analyse des Gesamtwerkes von John Locke<br />
mit, der sorgfältigen Ableitung von dessen Grundtheoremen aus den\<br />
Bedingungen des Zeitalters des frühbürgerlichen Konkurrenzkapitalismus<br />
übereinstimmt" (<strong>VI</strong>II). Es wäre mit einer solchen Ableitung —<br />
wie immer sie konkret aussähe — erst ein Teil der historisch-materialistischen<br />
Analyse einer Theorie geleistet. Dazu gehörte nämlich<br />
etwa die Frage, inwiefern sich der Klassencharakter einer Theorie<br />
gerade darin zeigt, daß sie bestimmte Elemente der in sie eingegangenen<br />
sozialen Realität ausspart (so unterschlägt z. B. Lockes Lehre<br />
vom Staat als Zusammenschluß freier Individuen — „frei" bedeutet<br />
im Sprachgebrauch der Zeit: besitzend — die Tatsache, daß im 17.<br />
Jahrhundert 50 % der englischen Bevölkerung unter dem Existenzminimum<br />
lebten). Doch muß man leider feststellen, daß Euchners<br />
Arbeit selbst den von Fetscher formulierten Ansprüchen nicht genügt.<br />
Euchner selbst faßt sein Ziel bescheidener und ambitionierter zugleich:<br />
„Die vorliegende Arbeit versucht, die einzelnen Lehrstücke<br />
des Lockeschen Naturrechts auf ihre Zugehörigkeit zur Tradition<br />
oder zur modernen bürgerlichen Sozialphilosophie zu befragen und<br />
somit das naturrechtliche Denken Lockes zu rekonstruieren; sie versteht<br />
sich als ein Beitrag zur Erhellung der Genese des bürgerlichen/<br />
politischen und sozialen Weltbildes" (13).<br />
Die geistesgeschichtliche Einordnung sowie die höchst umfangreiche<br />
Zusammenstellung der Lockeschen Äußerungen zum Naturrecht<br />
und eingehende Überprüfung der logischen Stringenz der<br />
Lockeschen Theoreme nimmt fast den gesamten Raum ein. Doch<br />
scheint auch Euchner unter dem Begriff der „Erhellung der Genese"<br />
mehr zu verstehen als geistesgeschichtliche Ableitung, aber wo er auf<br />
den sozialen Zusammenhang eingeht, dem Lockes Theorie entstammt<br />
und den sie zu beeinflussen versuchte, ersetzen vage Allgemeinheiten<br />
die erforderliche sozialhistorische Untersuchung.<br />
Euchner bezeichnet es als „thema probandum" seiner Arbeit (9) zu<br />
zeigen, wie Locke mit Theoremen des klassischen Naturrechts ansetzt<br />
und sie dann im Verlauf seiner Argumentation aushöhlt. Er kann<br />
aber die Funktion des formalen Festhaltens am traditionellen, stoischscholastischen<br />
Naturrecht im Hinblick auf die ideologische Verbrämung<br />
einer Theorie, die — wie Euchner selbst pauschal feststellt —<br />
zur „Sicherung der Eigentumsrechte der Bourgeoisie" (216) beitragen<br />
soll, nicht deutlich machen. Die tatsächliche Wirkung der Lockeschen<br />
Sozialphilosophie auf die englische Geschichte des 17. und frühen 18.<br />
Jahrhunderts wäre erst durch eine detaillierte historische Analyse<br />
zu klären. Da diese fehlt, bleibt die Beschreibung der Entwicklungsstadien<br />
der Lockeschen Naturrechtslehre bloße Philologie.<br />
Schon das Referat der Ergebnisse der neueren Locke-Forschung<br />
und der philosophiegeschichtliche Abriß über „Traditionelles und<br />
modernes Naturrecht" (14), den Euchner im Hinblick auf die Zuordnungskriterien<br />
als Exkurs einfügt, sind fixiert auf die Fragestellung: