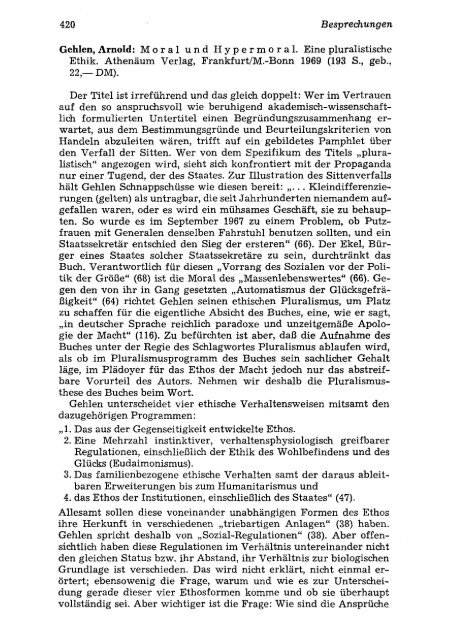Faschismus-Theorien (VI) / Diskussion - Berliner Institut für kritische ...
Faschismus-Theorien (VI) / Diskussion - Berliner Institut für kritische ...
Faschismus-Theorien (VI) / Diskussion - Berliner Institut für kritische ...
- Keine Tags gefunden...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
420 Besprechungen<br />
Gehlen, Arnold: Moral und Hypermoral. Eine pluralistische<br />
Ethik. Athenäum Verlag, Frankfurt/M.-Bonn 1969 (193 S., geb.,<br />
22,— DM).<br />
Der Titel ist irreführend und das gleich doppelt: Wer im Vertrauen<br />
auf den so anspruchsvoll wie beruhigend akademisch-wissenschaftlich<br />
formulierten Untertitel einen Begründungszusammenhang erwartet,<br />
aus dem Bestimmungsgründe und Beurteilungskriterien von<br />
Handeln abzuleiten wären, trifft auf ein gebildetes Pamphlet über<br />
den Verfall der Sitten. Wer von dem Spezifikum des Titels „pluralistisch"<br />
angezogen wird, sieht sich konfrontiert mit der Propaganda<br />
nur einer Tugend, der des Staates. Zur Illustration des Sittenverfalls<br />
hält Gehlen Schnappschüsse wie diesen bereit: „... Kleindifferenzierungen<br />
(gelten) als untragbar, die seit Jahrhunderten niemandem aufgefallen<br />
waren, oder es wird ein mühsames Geschäft, sie zu behaupten.<br />
So wurde es im September 1967 zu einem Problem, ob Putzfrauen<br />
mit Generalen denselben Fahrstuhl benutzen sollten, und ein<br />
Staatssekretär entschied den Sieg der ersteren" (66). Der Ekel, Bürger<br />
eines Staates solcher Staatssekretäre zu sein, durchtränkt das<br />
Buch. Verantwortlich für diesen „Vorrang des Sozialen vor der Politik<br />
der Größe" (68) ist die Moral des „Massenlebenswertes" (66). Gegen<br />
den von ihr in Gang gesetzten „Automatismus der Glücksgefräßigkeit"<br />
(64) richtet Gehlen seinen ethischen Pluralismus, um Platz<br />
zu schaffen für die eigentliche Absicht des Buches, eine, wie er sagt,<br />
„in deutscher Sprache reichlich paradoxe und unzeitgemäße Apologie<br />
der Macht" (116). Zu befürchten ist aber, daß die Aufnahme des<br />
Buches unter der Regie des Schlagwortes Pluralismus ablaufen wird,<br />
als ob im Pluralismusprogramm des Buches sein sachlicher Gehalt<br />
läge, im Plädoyer für das Ethos der Macht jedoch nur das abstreifbare<br />
Vorurteil des Autors. Nehmen wir deshalb die Pluralismusthese<br />
des Buches beim Wort.<br />
Gehlen unterscheidet vier ethische Verhaltensweisen mitsamt den<br />
dazugehörigen Programmen:<br />
„1. Das aus der Gegenseitigkeit entwickelte Ethos.<br />
2. Eine Mehrzahl instinktiver, verhaltensphysiologisch greifbarer<br />
Regulationen, einschließlich der Ethik des Wohlbefindens und des<br />
Glücks (Eudaimonismus).<br />
3. Das familienbezogene ethische Verhalten samt der daraus ableitbaren<br />
Erweiterungen bis zum Humanitarismus und<br />
4. das Ethos der <strong>Institut</strong>ionen, einschließlich des Staates" (47).<br />
Allesamt sollen diese voneinander unabhängigen Formen des Ethos<br />
ihre Herkunft in verschiedenen „triebartigen Anlagen" (38) haben.<br />
Gehlen spricht deshalb von „Sozial-Regulationen" (38). Aber offensichtlich<br />
haben diese Regulationen im Verhältnis untereinander nicht<br />
den gleichen Status bzw. ihr Abstand, ihr Verhältnis zur biologischen<br />
Grundlage ist verschieden. Das wird nicht erklärt, nicht einmal erörtert;<br />
ebensowenig die Frage, warum und wie es zur Unterscheidung<br />
gerade dieser vier Ethosformen komme und ob sie überhaupt<br />
vollständig sei. Aber wichtiger ist die Frage: Wie sind die Ansprüche