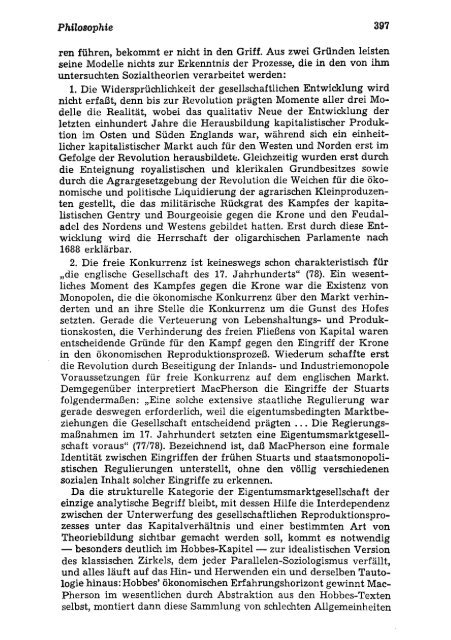Faschismus-Theorien (VI) / Diskussion - Berliner Institut für kritische ...
Faschismus-Theorien (VI) / Diskussion - Berliner Institut für kritische ...
Faschismus-Theorien (VI) / Diskussion - Berliner Institut für kritische ...
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Philosophie 397<br />
ren führen, bekommt er nicht in den Griff. Aus zwei Gründen leisten<br />
seine Modelle nichts zur Erkenntnis der Prozesse, die in den von ihm<br />
untersuchten Sozialtheorien verarbeitet werden:<br />
1. Die Widersprüchlichkeit der gesellschaftlichen Entwicklung wird<br />
nicht erfaßt, denn bis zur Revolution prägten Momente aller drei Modelle<br />
die Realität, wobei das qualitativ Neue der Entwicklung der<br />
letzten einhundert Jahre die Herausbildung kapitalistischer Produktion<br />
im Osten und Süden Englands war, während sich ein einheitlicher<br />
kapitalistischer Markt auch für den Westen und Norden erst im<br />
Gefolge der Revolution herausbildete. Gleichzeitig wurden erst durch<br />
die Enteignung royalistischen und klerikalen Grundbesitzes sowie<br />
durch die Agrargesetzgebung der Revolution die Weichen für die ökonomische<br />
und politische Liquidierung der agrarischen Kleinproduzenten<br />
gestellt, die das militärische Rückgrat des Kampfes der kapitalistischen<br />
Gentry und Bourgeoisie gegen die Krone und den Feudaladel<br />
des Nordens und Westens gebildet hatten. Erst durch diese Entwicklung<br />
wird die Herrschaft der oligarchischen Parlamente nach<br />
1688 erklärbar.<br />
2. Die freie Konkurrenz ist keineswegs schon charakteristisch für<br />
„die englische Gesellschaft des 17. Jahrhunderts" (78). Ein wesentliches<br />
Moment des Kampfes gegen die Krone war die Existenz von<br />
Monopolen, die die ökonomische Konkurrenz über den Markt verhinderten<br />
und an ihre Stelle die Konkurrenz um die Gunst des Hofes<br />
setzten. Gerade die Verteuerung von Lebenshaltungs- und Produktionskosten,<br />
die Verhinderung des freien Fließens von Kapital waren<br />
entscheidende Gründe für den Kampf gegen den Eingriff der Krone<br />
in den ökonomischen Reproduktionsprozeß. Wiederum schaffte erst<br />
die Revolution durch Beseitigung der Inlands- und Industriemonopole<br />
Voraussetzungen für freie Konkurrenz auf dem englischen Markt.<br />
Demgegenüber interpretiert MacPherson die Eingriffe der Stuarts<br />
folgendermaßen: „Eine solche extensive staatliche Regulierung war<br />
gerade deswegen erforderlich, weil die eigentumsbedingten Marktbeziehungen<br />
die Gesellschaft entscheidend prägten ... Die Regierungsmaßnahmen<br />
im 17. Jahrhundert setzten eine Eigentumsmarktgesellschaft<br />
voraus" (77/78). Bezeichnend ist, daß MacPherson eine formale<br />
Identität zwischen Eingriffen der frühen Stuarts und staatsmonopolistischen<br />
Regulierungen unterstellt, ohne den völlig verschiedenen<br />
sozialen Inhalt solcher Eingriffe zu erkennen.<br />
Da die strukturelle Kategorie der Eigentumsmarktgesellschaft der<br />
einzige analytische Begriff bleibt, mit dessen Hilfe die Interdependenz<br />
zwischen der Unterwerfung des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses<br />
unter das Kapitalverhältnis und einer bestimmten Art von<br />
Theoriebildung sichtbar gemacht werden soll, kommt es notwendig<br />
— besonders deutlich im Hobbes-Kapitel — zur idealistischen Version<br />
des klassischen Zirkels, dem jeder Parallelen-Soziologismus verfällt,<br />
und alles läuft auf das Hin- und Herwenden ein und derselben Tautologie<br />
hinaus: Hobbes' ökonomischen Erfahrungshorizont gewinnt Mac-<br />
Pherson im wesentlichen durch Abstraktion aus den Hobbes-Texten<br />
selbst, montiert dann diese Sammlung von schlechten Allgemeinheiten