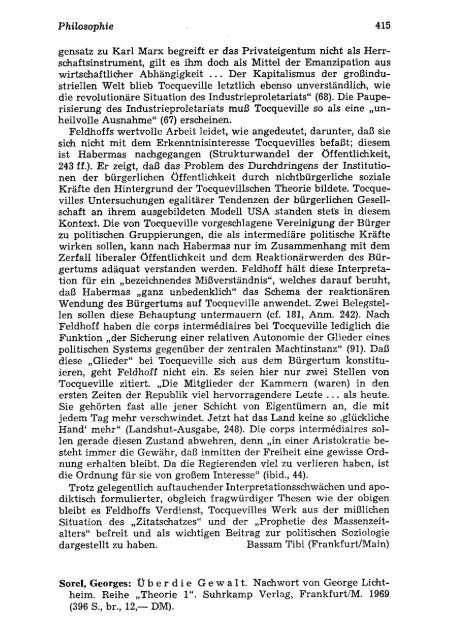Faschismus-Theorien (VI) / Diskussion - Berliner Institut für kritische ...
Faschismus-Theorien (VI) / Diskussion - Berliner Institut für kritische ...
Faschismus-Theorien (VI) / Diskussion - Berliner Institut für kritische ...
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Philosophie 415<br />
gensatz zu Karl Marx begreift er das Privateigentum nicht als Herrschaftsinstrument,<br />
gilt es ihm doch als Mittel der Emanzipation aus<br />
wirtschaftlicher Abhängigkeit ... Der Kapitalismus der großindustriellen<br />
Welt blieb Tocqueville letztlich ebenso unverständlich, wie<br />
die revolutionäre Situation des Industrieproletariats" (68). Die Pauperisierung<br />
des Industrieproletariats muß Tocqueville so als eine „unheilvolle<br />
Ausnahme" (67) erscheinen.<br />
Feldhoffs wertvolle Arbeit leidet, wie angedeutet, darunter, daß sie<br />
sich nicht mit dem Erkenntnisinteresse Tocquevilles befaßt; diesem<br />
ist Habermas nachgegangen (Strukturwandel der Öffentlichkeit,<br />
243 ff.). Er zeigt, daß das Problem des Durchdringens der <strong>Institut</strong>ionen<br />
der bürgerlichen Öffentlichkeit durch nichtbürgerliche soziale<br />
Kräfte den Hintergrund der Tocquevillschen Theorie bildete. Tocquevilles<br />
Untersuchungen egalitärer Tendenzen der bürgerlichen Gesellschaft<br />
an ihrem ausgebildeten Modell USA standen stets in diesem<br />
Kontext. Die von Tocqueville vorgeschlagene Vereinigung der Bürger<br />
zu politischen Gruppierungen, die als intermediäre politische Kräfte<br />
wirken sollen, kann nach Habermas nur im Zusammenhang mit dem<br />
Zerfall liberaler Öffentlichkeit und dem Reaktionärwerden des Bürgertums<br />
adäquat verstanden werden. Feldhoff hält diese Interpretation<br />
für ein „bezeichnendes Mißverständnis", welches darauf beruht,<br />
daß Habermas „ganz unbedenklich" das Schema der reaktionären<br />
Wendung des Bürgertums auf Tocqueville anwendet. Zwei Belegstellen<br />
sollen diese Behauptung untermauern (cf. 181, Anm. 242). Nach<br />
Feldhoff haben die corps intermédiaires bei Tocqueville lediglich die<br />
Funktion „der Sicherung einer relativen Autonomie der Glieder eines<br />
politischen Systems gegenüber der zentralen Machtinstanz" (91). Daß<br />
diese „Glieder" bei Tocqueville sich aus dem Bürgertum konstituieren,<br />
geht Feldhoff nicht ein. Es seien hier nur zwei Stellen von<br />
Tocqueville zitiert. „Die Mitglieder der Kammern (waren) in den<br />
ersten Zeiten der Republik viel hervorragendere Leute ... als heute.<br />
Sie gehörten fast alle jener Schicht von Eigentümern an, die mit<br />
jedem Tag mehr verschwindet. Jetzt hat das Land keine so ,glückliche<br />
Hand' mehr" (Landshut-Ausgabe, 248). Die corps intermédiaires sollen<br />
gerade diesen Zustand abwehren, denn „in einer Aristokratie besteht<br />
immer die Gewähr, daß inmitten der Freiheit eine gewisse Ordnung<br />
erhalten bleibt. Da die Regierenden viel zu verlieren haben, ist<br />
die Ordnung für sie von großem Interesse" (ibid., 44).<br />
Trotz gelegentlich auftauchender Interpretationsschwächen und apodiktisch<br />
formulierter, obgleich fragwürdiger Thesen wie der obigen<br />
bleibt es Feldhoffs Verdienst, Tocquevilles Werk aus der mißlichen<br />
Situation des „Zitatschatzes" und der „Prophetie des Massenzeitalters"<br />
befreit und als wichtigen Beitrag zur politischen Soziologie<br />
dargestellt zu haben.<br />
Bassam Tibi (Frankfurt/Main)<br />
Sorel, Georges: Überdie Gewalt. Nachwort von George Lichtheim.<br />
Reihe „Theorie 1". Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M. 1969<br />
(396 S., br., 12,— DM).