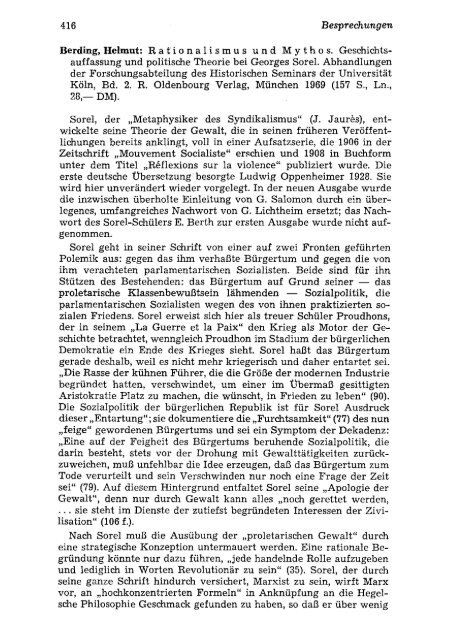Faschismus-Theorien (VI) / Diskussion - Berliner Institut für kritische ...
Faschismus-Theorien (VI) / Diskussion - Berliner Institut für kritische ...
Faschismus-Theorien (VI) / Diskussion - Berliner Institut für kritische ...
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
416 Besprechungen<br />
Berding, Helmut: Rationalismus und Mythos. Geschichtsauffassung<br />
und politische Theorie bei Georges Sorel. Abhandlungen<br />
der Forschungsabteilung des Historischen Seminars der Universität<br />
Köln, Bd. 2. R. Oldenbourg Verlag, München 1969 (157 S., Ln.,<br />
28,— DM).<br />
Sorel, der „Metaphysiker des Syndikalismus" (J. Jaurès), entwickelte<br />
seine Theorie der Gewalt, die in seinen früheren Veröffentlichungen<br />
bereits anklingt, voll in einer Aufsatzserie, die 1906 in der<br />
Zeitschrift „Mouvement Socialiste" erschien und 1908 in Buchform<br />
unter dem Titel „Réflexions sur la violence" publiziert wurde. Die<br />
erste deutsche Übersetzung besorgte Ludwig Oppenheimer 1928. Sie<br />
wird hier unverändert wieder vorgelegt. In der neuen Ausgabe wurde<br />
die inzwischen überholte Einleitung von G. Salomon durch ein überlegenes,<br />
umfangreiches Nachwort von G. Lichtheim ersetzt; das Nachwort<br />
des Sorel-Schülers E. Berth zur ersten Ausgabe wurde nicht aufgenommen.<br />
Sorel geht in seiner Schrift von einer auf zwei Fronten geführten<br />
Polemik aus: gegen das ihm verhaßte Bürgertum und gegen die von<br />
ihm verachteten parlamentarischen Sozialisten. Beide sind für ihn<br />
Stützen des Bestehenden: das Bürgertum auf Grund seiner — das<br />
proletarische Klassenbewußtsein lähmenden — Sozialpolitik, die<br />
parlamentarischen Sozialisten wegen des von ihnen praktizierten sozialen<br />
Friedens. Sorel erweist sich hier als treuer Schüler Proudhons,<br />
der in seinem „La Guerre et la Paix" den Krieg als Motor der Geschichte<br />
betrachtet, wenngleich Proudhon im Stadium der bürgerlichen<br />
Demokratie ein Ende des Krieges sieht. Sorel haßt das Bürgertum<br />
gerade deshalb, weil es nicht mehr kriegerisch und daher entartet sei.<br />
„Die Rasse der kühnen Führer, die die Größe der modernen Industrie<br />
begründet hatten, verschwindet, um einer im Übermaß gesittigten<br />
Aristokratie Platz zu machen, die wünscht, in Frieden zu leben" (90).<br />
Die Sozialpolitik der bürgerlichen Republik ist für Sorel Ausdruck<br />
dieser „Entartung"; sie dokumentiere die „Furchtsamkeit" (77) des nun<br />
„feige" gewordenen Bürgertums und sei ein Symptom der Dekadenz:<br />
„Eine auf der Feigheit des Bürgertums beruhende Sozialpolitik, die<br />
darin besteht, stets vor der Drohung mit Gewalttätigkeiten zurückzuweichen,<br />
muß unfehlbar die Idee erzeugen, daß das Bürgertum zum<br />
Tode verurteilt und sein Verschwinden nur noch eine Frage der Zeit<br />
sei" (79). Auf diesem Hintergrund entfaltet Sorel seine „Apologie der<br />
Gewalt", denn nur durch Gewalt kann alles „noch gerettet werden,<br />
... sie steht im Dienste der zutiefst begründeten Interessen der Zivilisation"<br />
(106 f.).<br />
Nach Sorel muß die Ausübung der „proletarischen Gewalt" durch<br />
eine strategische Konzeption untermauert werden. Eine rationale Begründung<br />
könnte nur dazu führen, „jede handelnde Rolle aufzugeben<br />
und lediglich in Worten Revolutionär zu sein" (35). Sorel, der durch<br />
seine ganze Schrift hindurch versichert, Marxist zu sein, wirft Marx<br />
vor, an „hochkonzentrierten Formeln" in Anknüpfung an die Hegelsche<br />
Philosophie Geschmack gefunden zu haben, so daß er über wenig