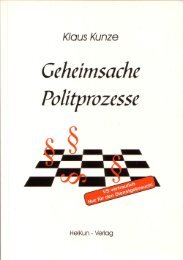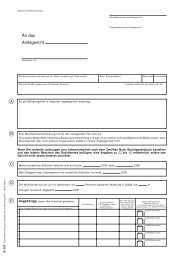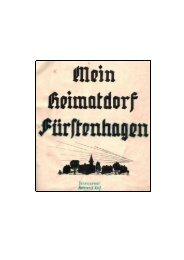pdf-Version - Klaus Kunze
pdf-Version - Klaus Kunze
pdf-Version - Klaus Kunze
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
123<br />
___________________________________________________________<br />
formes Maß reduziert werden, indem außer den direkten Zuwendungen (Wahlkampfkostenerstattung,<br />
Sockelbeträge, Chancenausgleich usw.) auch die indirekten<br />
Zahlungen in die Berechnung der Staatsquote einbezogen werden. Diese<br />
ist der staatliche Anteil an der Parteienfinanzierung und darf nach ständiger<br />
Rechtsprechung 426 nicht über dem Eigenfinanzierungsanteil liegen.<br />
Bereits heute wird aber das verfassungsrechtliche Verbot für die Parteien,<br />
sich überwiegend aus Staatsmitteln zu finanzieren, nur durch organisatorische<br />
Tricks eingehalten: Die Parteien haben nämlich einen großen Teil ihrer Organisation,<br />
beispielsweise ihre "Denkfabriken", in Form rechtlich selbständiger Parteistiftungen<br />
ausgegliedert, die staatlich finanziert werden, bei der Berechnung<br />
der Staatsquote aber formell nicht mitzählen. Das gilt auch für die Milliardensummen,<br />
die jährlich in Form von Diäten unzähliger Abgeordneten auf Bundes-<br />
, Landes- und Kommunalebene an Parteivertreter nebst Fraktionszuschüssen,<br />
Dienstwagen, wissenschaftlichen Mitarbeitern und anderen Extras gezahlt werden<br />
und deren rechnerische Einbeziehung in die Staatsquote Vierhaus zu Recht<br />
fordert.<br />
Mit jedem dieser Ausgabenposten ist aber ein menschliches Schicksal verbunden,<br />
nämlich die persönliche Versorgung eines Parlamentariers oder von<br />
ihm abhängigen Angestellten. Schon die angesichts der Haushaltslage von Bundeskanzler<br />
Kohl im April 1992 angekündigte Kürzung der Ministergehälter war<br />
nicht durchsetzbar, und eine freiwillige Selbstbeschränkung der Parteienmacht<br />
wird immer wieder an deren gegengerichtetem Eigeninteresse scheitern. So realistisch<br />
sieht das auch das BVerfG, wenn es ausführt, "ähnlich wie bei der Festlegung<br />
der Bezüge von Abgeordneten und sonstigen Inhabern politischer Ämter<br />
ermangelt das Gesetzgebungsverfahren" im Bereich der Parteienfinanzierung<br />
"regelmäßig des korrigierenden Elements gegenläufiger politischer Interessen."<br />
427 Kurz: Bei der Diätenerhöhung ist man sich ebenso einig wie beim Zugriff<br />
der Parteivertreter auf Haushaltsmittel.<br />
Vor allem aber darf der liberale Parteienstaat seinen Zugriff auf Ämter und<br />
Versorgungsposten um den Preis seines Machterhalts nicht aufgeben: Jede Partei<br />
ist bestrebt, ihrer Organisation eine möglichst breite Machtbasis zu geben.<br />
Die Parteiherrschaft ist eine Herrschaft weniger; wenn diese Wenigen aber zu<br />
wenige werden, gerät sie in Gefahr, von der Mehrheit nicht Privilegierter aus<br />
den Angeln gehoben zu werden. Sie muß daher bestrebt sein, möglichst viele<br />
426 BVerfG E 20, 56 (101); 73, 40 (87) u.a.m.<br />
427 BVerfG Urteil v.9.4.1992, NJW 1992, 2545; Arnim, Die Partei..., S.8.