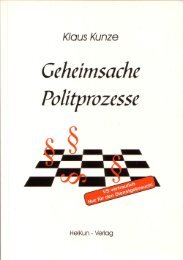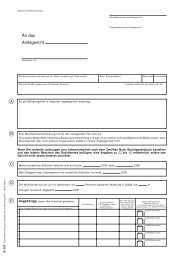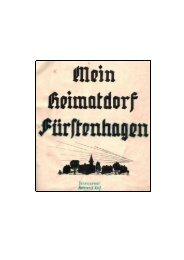pdf-Version - Klaus Kunze
pdf-Version - Klaus Kunze
pdf-Version - Klaus Kunze
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
185<br />
___________________________________________________________<br />
rän ein Schnippchen, ohne daß dieses es bemerkte: Sie machten sich die Regierung<br />
botmäßig und begründeten, nicht dem Verfassungsbuchstaben, aber der<br />
Sache nach, eine Art eigener Souveränität, nämlich die der Gesellschaft über<br />
den Staat. Der Schlag vom 28.10.1918 war formal noch gegen den Kaiser als<br />
alten Souverän geführt worden und durfte seine Legitimität auf die Souveränität<br />
des Volkes stützen. Dieses aber handelte ihm Rahmen des neu installierten<br />
Parlamentarismus nicht selbst, sondern durch das Parlament. Während die<br />
Parteienvertreter das Volk nur nominell als souveränen Herrscher einsetzten,<br />
wußten sie sich im tatsächlichen Besitz der maßgeblichen Gewalten, der entscheidenden<br />
Hebel der Macht: der Gesetzgebung und dem Zugriff auf das Amt<br />
des Reichskanzlers. Dieser wurde zwar formell vom Reichspräsidenten ernannt,<br />
bedurfte aber des Vertrauens des Reichstags.<br />
Diese Machtergreifung wirkte über die Augenblickslage weit hinaus und<br />
trug nicht nur zur schließlichen Abdankung des faktisch schon entmachteten<br />
Kaisers bei; die Weimarer Parteien gaben die Macht auch danach nicht wieder<br />
her. Daß das Volk nach der Weimarer Verfassung mit dem Reichspräsidenten<br />
noch einen direkt gewählten Vertreter und damit einen Verfechter des Gemeinwohls<br />
hatte, half ihm nicht. Paul von Hindenburg nahm als Reichspräsident die<br />
ihm obliegende Neutralität über die Parteien ausgesprochen ernst. Die wirkliche<br />
Macht lag aber nicht in seinen Händen. "Die parlamentarische Verantwortlichkeit<br />
der Reichsregierung, die jederzeit durch ein Mißtrauensvotum<br />
von der Mehrheit des Reichstags abberufen werden konnte (Art.54 WRVerf),<br />
machte praktisch die gesamte Regierungstätigkeit zum Gegenstand<br />
parlamentarischer Kognition." 582 Diesen Zustand hat das Grundgesetz noch<br />
verschärft, indem es dem Bundespräsidenten gegenüber dem Parlament die<br />
Rechte vorenthält, die der Weimarer Reichspräsident noch gehabt hatte. 583<br />
Zu konstitutionell-monarchischen Zeiten rechtfertigte sich die Idee der<br />
parlamentarischen Regierungsform als systemüberwindendes Kampfinstrument<br />
gegen die Idee der monarchischen Souveränität: Dem Monarchen sollte die<br />
Verantwortlichkeit für die Regierungsgewalt entwunden werden, weil er keine<br />
demokratische Legitimation besaß. Nach 1918 wurde die Idee der parlamentarischen<br />
Regierungsform mit den Worten Roman Herzogs "in die demokratische<br />
Epoche herübergeschleppt", die Exekutive "demokratisiert", ihr jede Tätigkeit<br />
582 Forsthoff, Verfassungsgeschichte der Neuzeit, S.172.<br />
583 Zum Zustandekommen des Grundgesetz mit seiner noch weitergehenden Auflösung des<br />
Staates gegenüber der Gesellschaft vgl. Maschke, Criticón 1985,153 (154): "Wie jedes Geschenk<br />
eines Siegers, so diente auch dieses der Schwächung des Besiegten."