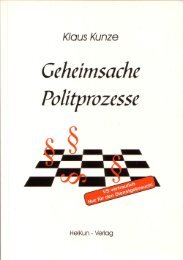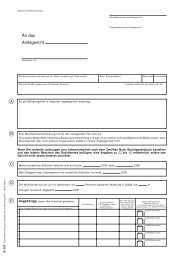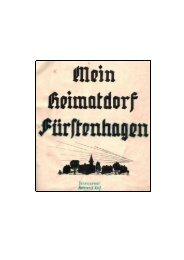pdf-Version - Klaus Kunze
pdf-Version - Klaus Kunze
pdf-Version - Klaus Kunze
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
40<br />
___________________________________________________________<br />
nelle Gewaltenteilung, die sich in Unvereinbarkeiten konkretisiert. 165 Suche<br />
man nach Rechtfertigungsgründen für die Vereinbarkeit von Regierungsamt<br />
und Abgeordnetenmandat, so finde man nur mehr oder minder pauschale<br />
Hinweise auf "die parlamentarische Tradition" oder auf 'das parlamentarische<br />
Regierungssystem'. Mit solchen Allgemeinplätzen lasse die Zwittergestalt eines<br />
Abgeordnetenministers oder Ministerabgeordneten sich aber nicht halten.<br />
Die Rechtfertigungsversuche aus Kreisen der Nutznießer der Parteienstaatlichkeit<br />
laufen auf zwei Hauptargumente gegen den Befund hinaus, nach dem<br />
es Gewaltenteilung im eigentlichen Sinn in Deutschland heute nicht gibt: Zum<br />
einen werde die geballte Macht des relativen Absolutismus, der durch die<br />
unumschränkte Herrschaft der Parlamentsmajorität (auf Dauer einer Legislaturperiode)<br />
geschaffen wird, dadurch gemildert, daß es zwei Parteien gebe, die<br />
sich in der Herrschaft regelmäßig ablösten. Zum anderen gewährleiste der Föderalismus<br />
eine gänzlich neue Art vertikaler Gewaltenteilung. Das Argument<br />
mit den einander ablösenden Parteien mag vielleicht im England vergangener<br />
Jahrhunderte funktioniert haben. Die heutigen Großparteien aber durchdringen<br />
alle Lebensbereiche und wollen gemeinsam jede Alternative vom Zugang zu<br />
Macht und Pfründen ausschließen. Ein Wettbewerb mit gewaltenteilender Nebenwirkung<br />
fällt daher aus. 166 Ihre politischen Positionen ähneln einander zum<br />
Verwechseln. Überdies hat seit Bestehen der Bundesrepublik noch nicht ein<br />
einziges Mal das Volk in einer Bundestagswahl einen Regierungswechsel<br />
erreicht, weil ungeachtet der Stärke der beiden Großparteien stets die FDP als<br />
Mehrheitsbeschaffer den Ausschlag für die eine oder die andere Koalitionsregierung<br />
gab. Das Argument der Machtminderung durch zwei ausbalancierte<br />
Parteien zieht also nicht. Auch das Argument, der Föderalismus schaffe eine<br />
Machtaufgliederung neuer Art, ersetzt nicht die Notwendigkeit der klassischen<br />
Gewaltenteilung. Die Übermacht der Großstrukturen politischer Massenparteien<br />
bricht sich keineswegs an Ländergrenzen.<br />
Das entscheidende Versagen des Grundgesetzes liegt darin, daß es eine reine<br />
Parteienparlaments-Herrschaft zuläßt und seinen Parlamentsparteien den unumschränkten<br />
Zugriff auf alle Gewalten ermöglicht, weil es ihn nicht verbietet. So<br />
entstand das Gegenteil von einer Gewaltenteilung: eine Gewaltenverfilzung 167<br />
nämlich. Die Gewaltenteilung ist hier und heute kein echtes politisches<br />
165 v. Münch beruft sich hier auf: Herzog, in: Maunz1Dürig, Art. 20 V Rdn. 16; vgl. aber auch<br />
ders., Art. 20 V Rdnr. 46.<br />
166 Arnim, FAZ 27.11.1993.<br />
167 Roman Herzog, in M-D-H, Art.20 GG, V. Rdn.29.