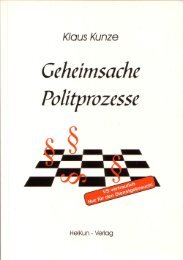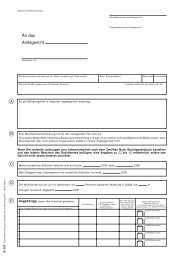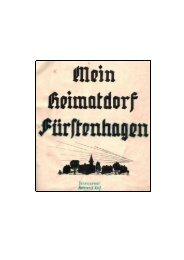pdf-Version - Klaus Kunze
pdf-Version - Klaus Kunze
pdf-Version - Klaus Kunze
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
DIE TRENNUNG VON STAAT UND<br />
GESELLSCHAFT<br />
DIE DIREKTWAHL DES BUNDESPRÄSIDENTEN<br />
183<br />
Das Plebiszit ist, wie jede Wahl, "das elementarste Sicherheitsventil gegen<br />
oligarchische Giftdämpfe." 579 Es ragt aber nicht bloß als Destruktionswaffe<br />
hervor, indem es das Repräsentativprinzip durchlöchert, jenes Bollwerk der<br />
Parteienmacht. Es ist vielmehr in Gestalt einer Volkswahl des Bundespräsidenten<br />
auch konstruktiv unentbehrlich. Unter demokratischen Prämissen muß<br />
jede Regierung, überhaupt jede Staatstätigkeit, durch eine Wahl demokratisch<br />
legitimiert sein. Die Direktwahl des Bundespräsidenten durch das Volk wie in<br />
der Weimarer Republik und heute in Frankreich wäre eine solche Legitimation.<br />
Sie würde eine volle Nutzung des Präsidentenamtes im Rahmen des Verfassungssystems<br />
ermöglichen. Heute ist das wegen der doppelt indirekten Wahl<br />
des Präsidenten nicht möglich: Der prozeduralen Distanz zwischen Volk und<br />
Präsidentenamt entspricht die geringe Kompetenz seines Inhabers. Die innere<br />
Logik des Liberalismus will mit möglichst wenig Staat auskommen und<br />
benötigt die Amtsfunktion eines regierenden Staatsoberhauptes nicht.<br />
Wir brauchen aber das Präsidentenamt konstruktiv für die die gewaltenteilende<br />
Trennung von Staat und Gesellschaft und um das Repräsentationsdefizit<br />
bezüglich des Gemeinwohls zu füllen. Das kann das Amt nach heutigem<br />
Verfassungszustand nicht leisten. In der Zeit des Fürstenabsolutismus hatte sich<br />
der Staat gegenüber der Gesellschaft in der Person des Monarchen verkörpert,<br />
seinen Ministern und seinem Heer. Zwischen ihm und der gesellschaftlichen<br />
Repräsentation, dem Parlament, hat seit Einführung konstitutioneller Verfassungen<br />
in Deutschland bis 1918 meist ein Schwebezustand geherrscht. Beide<br />
Gewalten hielten ein Machtgleichgewicht, obwohl jede Seite die anderen gerne<br />
überwunden hätte. Es liegt in der Logik des Gegensatzes zwischen Staat und<br />
Gesellschaft, daß jede Seite gern zur Absolutheit werden möchte. Solange das<br />
keiner Seite gelingt, sind wir Bürger so frei wir irgend möglich. Abgesehen von<br />
behebbaren demokratischen Schönheitsfehlern wie einem ungleichen<br />
Wahlrecht hatte die Reichsverfassung vom 16.4.1871 diese Grundbedingung<br />
bürgerlicher Freiheit erfüllt, indem sie Staat und Gesellschaft trennte. Mon-<br />
579 Michels, Soziologie, S.93.