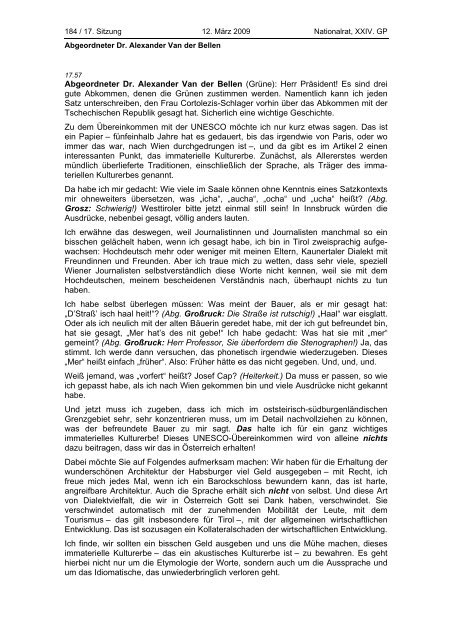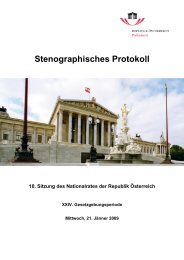Stenographisches Protokoll - Andrea Gessl-Ranftl
Stenographisches Protokoll - Andrea Gessl-Ranftl
Stenographisches Protokoll - Andrea Gessl-Ranftl
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
184 / 17. Sitzung 12. März 2009 Nationalrat, XXIV. GP<br />
Abgeordneter Dr. Alexander Van der Bellen<br />
17.57<br />
Abgeordneter Dr. Alexander Van der Bellen (Grüne): Herr Präsident! Es sind drei<br />
gute Abkommen, denen die Grünen zustimmen werden. Namentlich kann ich jeden<br />
Satz unterschreiben, den Frau Cortolezis-Schlager vorhin über das Abkommen mit der<br />
Tschechischen Republik gesagt hat. Sicherlich eine wichtige Geschichte.<br />
Zu dem Übereinkommen mit der UNESCO möchte ich nur kurz etwas sagen. Das ist<br />
ein Papier – fünfeinhalb Jahre hat es gedauert, bis das irgendwie von Paris, oder wo<br />
immer das war, nach Wien durchgedrungen ist –, und da gibt es im Artikel 2 einen<br />
interessanten Punkt, das immaterielle Kulturerbe. Zunächst, als Allererstes werden<br />
mündlich überlieferte Traditionen, einschließlich der Sprache, als Träger des immateriellen<br />
Kulturerbes genannt.<br />
Da habe ich mir gedacht: Wie viele im Saale können ohne Kenntnis eines Satzkontexts<br />
mir ohneweiters übersetzen, was „icha“, „aucha“, „ocha“ und „ucha“ heißt? (Abg.<br />
Grosz: Schwierig!) Westtiroler bitte jetzt einmal still sein! In Innsbruck würden die<br />
Ausdrücke, nebenbei gesagt, völlig anders lauten.<br />
Ich erwähne das deswegen, weil Journalistinnen und Journalisten manchmal so ein<br />
bisschen gelächelt haben, wenn ich gesagt habe, ich bin in Tirol zweisprachig aufgewachsen:<br />
Hochdeutsch mehr oder weniger mit meinen Eltern, Kaunertaler Dialekt mit<br />
Freundinnen und Freunden. Aber ich traue mich zu wetten, dass sehr viele, speziell<br />
Wiener Journalisten selbstverständlich diese Worte nicht kennen, weil sie mit dem<br />
Hochdeutschen, meinem bescheidenen Verständnis nach, überhaupt nichts zu tun<br />
haben.<br />
Ich habe selbst überlegen müssen: Was meint der Bauer, als er mir gesagt hat:<br />
„D’Straß’ isch haal heit!“? (Abg. Großruck: Die Straße ist rutschig!) „Haal“ war eisglatt.<br />
Oder als ich neulich mit der alten Bäuerin geredet habe, mit der ich gut befreundet bin,<br />
hat sie gesagt, „Mer hat’s des nit gebe!“ Ich habe gedacht: Was hat sie mit „mer“<br />
gemeint? (Abg. Großruck: Herr Professor, Sie überfordern die Stenographen!) Ja, das<br />
stimmt. Ich werde dann versuchen, das phonetisch irgendwie wiederzugeben. Dieses<br />
„Mer“ heißt einfach „früher“. Also: Früher hätte es das nicht gegeben. Und, und, und.<br />
Weiß jemand, was „vorfert“ heißt? Josef Cap? (Heiterkeit.) Da muss er passen, so wie<br />
ich gepasst habe, als ich nach Wien gekommen bin und viele Ausdrücke nicht gekannt<br />
habe.<br />
Und jetzt muss ich zugeben, dass ich mich im oststeirisch-südburgenländischen<br />
Grenzgebiet sehr, sehr konzentrieren muss, um im Detail nachvollziehen zu können,<br />
was der befreundete Bauer zu mir sagt. Das halte ich für ein ganz wichtiges<br />
immaterielles Kulturerbe! Dieses UNESCO-Übereinkommen wird von alleine nichts<br />
dazu beitragen, dass wir das in Österreich erhalten!<br />
Dabei möchte Sie auf Folgendes aufmerksam machen: Wir haben für die Erhaltung der<br />
wunderschönen Architektur der Habsburger viel Geld ausgegeben – mit Recht, ich<br />
freue mich jedes Mal, wenn ich ein Barockschloss bewundern kann, das ist harte,<br />
angreifbare Architektur. Auch die Sprache erhält sich nicht von selbst. Und diese Art<br />
von Dialektvielfalt, die wir in Österreich Gott sei Dank haben, verschwindet. Sie<br />
verschwindet automatisch mit der zunehmenden Mobilität der Leute, mit dem<br />
Tourismus – das gilt insbesondere für Tirol –, mit der allgemeinen wirtschaftlichen<br />
Entwicklung. Das ist sozusagen ein Kollateralschaden der wirtschaftlichen Entwicklung.<br />
Ich finde, wir sollten ein bisschen Geld ausgeben und uns die Mühe machen, dieses<br />
immaterielle Kulturerbe – das ein akustisches Kulturerbe ist – zu bewahren. Es geht<br />
hierbei nicht nur um die Etymologie der Worte, sondern auch um die Aussprache und<br />
um das Idiomatische, das unwiederbringlich verloren geht.