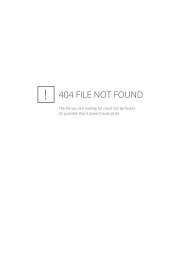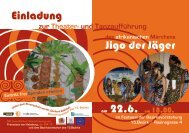Das Titelbild („Der Baum“) wurde auf einem ... - Afrikanet.info
Das Titelbild („Der Baum“) wurde auf einem ... - Afrikanet.info
Das Titelbild („Der Baum“) wurde auf einem ... - Afrikanet.info
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Einleitung 13<br />
Mehrheit der Menschen aus der Dritten Welt als auch für marginalisierte und ausgegrenzte Bevölkerungsschichten<br />
in der Ersten Welt - so würde ich hinzufügen - und verlangt in letzter Konsequenz<br />
ein neues wissenschaftliches Paradigma. Da es eine wirklich wertfreie Wissenschaft<br />
nicht geben kann, wird das bewußte Einnehmen eines „advocacy-stance“ und dessen Offenlegung<br />
zu <strong>einem</strong> wichtigen Kriterium für wissenschaftliches Arbeiten - und ist zugleich ein Ausdruck<br />
wissenschaftlicher Redlichkeit.<br />
Von gelegentlichen Kindergottesdienstbesuchen abgesehen begann meine christliche<br />
Sozialisation erst mit meiner Konfirmandenzeit. Zu dieser Zeit machte ich mir zum<br />
ersten Mal Gedanken über Gott. Ich fragte mich damals, ob es Gott gebe oder nicht,<br />
konnte jedoch zu keiner Entscheidung über seine Existenz kommen. Dessenungeachtet<br />
kam ich zu dem Schluß, daß, egal ob es Gott gibt oder nicht 3 , zumindest an den Zehn<br />
Geboten ,etwas dran‘ ist, insofern sie <strong>auf</strong> sozial gerechte Verhältnisse hinausl<strong>auf</strong>en.<br />
Der christliche Kontext, in den ich hineinsozialisiert worden war, ist das pietistisch-evangelikal<br />
geprägte Christentum des nördlichen Landkreises von Karlsruhe. Stichworte: Erweckungsbewegung<br />
Henhöfers und regelmäßige Henhöfertage, AB-Gemeinschaften und Bibelstunden, Bibelschule<br />
Adelshofen und Evangelisationen ...<br />
Früh schon hatte ich ein starkes Interesse für die Bibel entwickelt, ich wollte sie - damals<br />
noch in <strong>einem</strong> vermeintlich wörtlichen Sinn - verstehen und ernst nehmen. Wohl<br />
<strong>auf</strong>grund meiner Erfahrung dessen, was es heißt, in einer reichen Gesellschaft arm zu<br />
sein, war ich schon zu dieser Zeit sensibel für sozialkritische Bibeltexte, die von den<br />
Evangelikalen geflissentlich übersehen bzw. mehr oder weniger bewußt zurechtgestutzt<br />
werden. Wie sich später erweisen sollte, lag darin eine gewisse Sprengkraft für<br />
die pietistisch-evangelikalen ,Fesseln‘, durch die mein Verständnis des christlichen<br />
Glaubens gebunden war. 4<br />
3<br />
4<br />
ihren Beitrag über Feministische Hermeneutik in: CHRISTINE SCHAUMBERGER und MONIKA MAAßEN, Handbuch<br />
Feministische Theologie, Münster (Morgana Frauenbuchverlag), 1986, 256-284.<br />
Später, im L<strong>auf</strong>e meines Theologiestudiums, bin ich <strong>auf</strong> PAUL TILLICH gestoßen, der bemerkt: „Es ist<br />
ebenso Atheismus, die Existenz Gottes zu behaupten, wie es Atheismus ist, sie zu leugnen“ (Systematische<br />
Theologie I, Berlin (de Gruyter), 1987, S. 275). So bin ich inzwischen zu der Auffassung gekommen,<br />
daß die „Existenz“ Gottes im Kontext unserer okzidentalen Vorstellungen von Sein keine Denkmöglichkeit<br />
ist und die Frage danach irrelevant. Mehr noch, nichts, was existiert, kann je den Anspruch<br />
erheben, Gott zu sein. Und wenn doch, dann ist dies nichts anderes als ein „Gott-Nichts“ (Buber), ein<br />
Götze - was freilich noch nichts über dessen gesellschaftliche Wirksamkeit aussagt, ist doch nach<br />
CHRISTOPH TÜRCKE „die Aufrechterhaltung der Kapitalzirkulation ein gigantischer Fetischdienst [...], ein<br />
gesamtgesellschaftlicher Gottesdienst, der nicht nur sonntags zwischen zehn und elf stattfindet, sondern<br />
rund um die Uhr, und auch die zur Teilnahme zwingt, die seinen Fetischcharakter durchschauen; denn<br />
auch die müssen leben“ (Kassensturz. Zur Lage der Theologie, Frankfurt am Main (Fischer), 1992, S.<br />
31).<br />
Meine pietistisch-evangelikale Prägung ist sicher nicht zu leugnen, jedoch ist sie, wie ich denke, mittlerweile,<br />
geläutert‘: Noch immer ist es mir wichtig, die Bibel zu verstehen, jedoch ist mir heute klar, daß<br />
dies ohne Berücksichtigung der verschiedenen Kontexte - einerseits der literarische und historische<br />
(d.h.: kulturelle, soziale, ökonomische und politische) Kontext der Bibel und andererseits der Kontext<br />
des Interpreten bzw. der Interpretin - unmöglich ist, ein intuitives Verständnis (z.B. <strong>auf</strong> der Grundlage<br />
ähnlicher Kontexte; vgl. z.B. <strong>Das</strong> Evangelium der Bauern von Solentiname) einmal ausgenommen. Auch<br />
die Bibel ernst zu nehmen, ist mir noch immer ein Anliegen, jedoch heißt dies für mich heute gerade<br />
auch, Kritik zu äußern, v.a. immanente („Kanon im Kanon“, besser: „semantische Achsen“; innere Widersprüche),<br />
aber auch eine solche, die von aktuellen Erfahrungen und Problemstellungen ausgeht (z.B.<br />
im Sinn einer „Hermeneutik des Verdachts“). Dies setzt die Anerkennung der Tatsache voraus, daß die<br />
Bibel selbst (und insbesondere als Kanon) das Produkt von Machtkämpfen und Interessenskonflikten ist,<br />
die sich in verschiedenen (konträren) Traditionen widerspiegeln. - Ein Beispiel: Ich frage mich, ob in