Stimmengewirr oder Dialog? - Bakom - CH
Stimmengewirr oder Dialog? - Bakom - CH
Stimmengewirr oder Dialog? - Bakom - CH
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Theoretische Verortung der Untersuchung<br />
laws that habituate us are good laws. It is through deliberation that belief and narrow interest<br />
are at least potentially exposed to reasoned examination in a democracy” (Terchek,<br />
Moore 2000: 905, 907, Hervorhebung v. Verf.). Später, im Zeitalter der Aufklärung beschäftigt<br />
sich dann u.a. Kant mit der Rolle des öffentlichen Räsonierens als der Vermittlung<br />
zwischen Moral und Politik, so dass Politik im Namen der Moral rationalisiert wird<br />
und „einzig Vernunft Gewalt hat“. 5 Auch Rousseau und später Hegel, Marx, Mill und Tocqueville<br />
haben sich als politische Theoretiker allesamt mit dem Themenkomplex der Struktur<br />
und Funktion öffentlicher Auseinandersetzung, der öffentlichen Meinung und der Öffentlichkeit<br />
selbst beschäftigt (vgl. Habermas 1990, 1992; Steiner et al. 2004). 6<br />
Für die jüngere politische Theorie ist es indes Bernard Manin, der 1987 in einem Aufsatz<br />
die Frage nach der Legitimation politischer Entscheidungen stellt und zum Ergebnis<br />
kommt, dass diese in erster Linie durch die Art und Weise der Erörterungen politischer<br />
Anliegen entsteht: „[T]he source of legitimacy is not the predetermined will of individuals,<br />
but rather the process of its formation, that is, deliberation itself […]” (Manin 1987: 351-<br />
352, Hervorhebung v. Verf.). Joshua Cohen argumentiert zwei Jahre später ganz ähnlich,<br />
als er in der öffentlichen politischen Auseinandersetzung die legitimierende Kraft demokratischer<br />
Entscheidungen sieht: „The notion of deliberative democracy is rooted in the<br />
intuitive ideal of a democratic association in which the justification of the terms and conditions<br />
of association proceeds through public argument and reasoning among equal citizens“<br />
(Cohen 1989: 21, Hervorhebung v. Verf.). Demokratische Politik bedeutet dabei<br />
auch, dass die Identität der BürgerInnen bzw. ihre Interessen zum grossen Teil durch Deliberation<br />
geformt werden (Cohen 1989) – ja die TeilnehmerInnen unter Umständen ihrer<br />
Präferenzen <strong>oder</strong> Präferenzordnungen erst durch Deliberation gewahr werden. Cohen geht<br />
indes noch einen Schritt weiter als Manin, indem er nicht nur für den Begriff der deliberativen<br />
Demokratie plädiert, sondern auch die Umrisse eines institutionellen Verfahrens<br />
skizziert, das die Legitimität der Entscheidungen garantieren bzw. herbeiführen soll. Das<br />
Augenmerk gilt dabei insbesondere der Deliberation als „Rechtfertigungszusammenhang“<br />
(vgl. Habermas 1992) und kann mit Habermas zusammenfassend folgendermassen charakterisiert<br />
werden: 7<br />
Die Beratung vollzieht sich in argumentativer Form zwischen Parteien, die Vorschläge<br />
einbringen und kritisch prüfen.<br />
Die Beratungen sind inklusiv und öffentlich. Niemand darf ausgeschlossen werden. Alle<br />
von den Beschlüssen möglicherweise Betroffenen haben die gleiche Chance des Zugangs<br />
und der Teilnahme.<br />
5 Bei Kant wie bei Habermas ergibt sich – freilich auf unterschiedliche Weise – aus dem Status und der<br />
Funktion der Deliberation das Prinzip der Öffentlichkeit als einer Sphäre bzw. bei jüngeren Arbeiten von<br />
Habermas als eines Prozesses, der zwischen Staat und Gesellschaft vermittelt (vgl. Habermas 1990, 1992).<br />
6 Wobei Rousseau am wenigsten von allen auf die Kraft der öffentlichen Deliberation setzt, ja sich explizit<br />
dagegen wendet, da der Austausch von Meinungen und Gründen den Willen des Einzelnen verfälscht, Einzelinteressen<br />
den Vorzug gibt und so auf die Gemeinschaft zersetzend wirkt (vgl. Rousseau 1966). Demgegenüber<br />
setzt Kant gerade auf die „zivilisierende Kraft“ der Öffentlichkeit zur Lösung eines Problems, das er<br />
in seinem Entwurf „zum ewigen Frieden“ theoretisch folgendermassen stellt: „eine Menge von vernünftigen<br />
Wesen, die insgeheim allgemein Gesetze für ihre Erhaltung verlangen, deren jedes aber insgeheim sich davon<br />
auszunehmen geneigt ist, so zu ordnen und ihre Verfassung einzurichten, dass, obgleich sie in ihren Privatgesinnungen<br />
einander entgegenstreben, diese einander doch so aufhalten, dass in ihrem öffentlichen Verhalten<br />
der Erfolg ebenderselbe ist, als ob sie keine solche bösen Gesinnungen hätten“ (Kant 1983: 224).<br />
7 Mit diesem vorwiegend formalen Ansatz an die Deliberation unterscheidet sich Cohen wie auch später<br />
Habermas (1992), Bohman (1996), Rheg (1994) u.a. von den sogenannten „Substantivisten“ innerhalb des<br />
deliberativen Paradigmas. Substantivisten, zu deren prominentesten Vertretern Gutmann und Thompson<br />
gehören (1996, 2004), plädieren dafür, dass nicht nur formale Kriterien, sondern eben auch substantielle<br />
Bedingungen Teil des deliberativen Verfahrens sein sollen (vgl. Gutmann und Thompson 1996, 2004; kritisch<br />
dazu Dryzek 2000).<br />
13


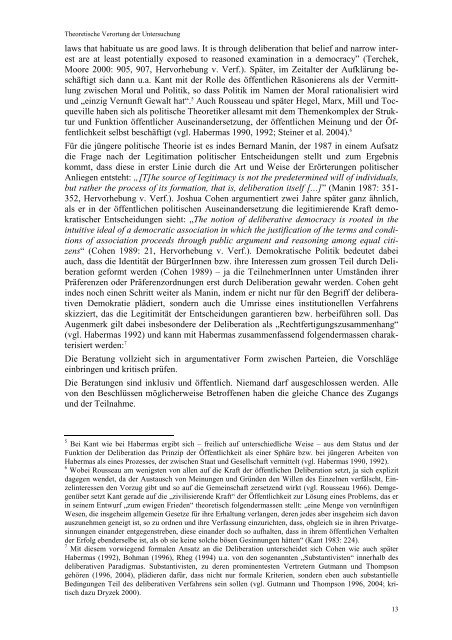



![Präsentation von H. Hofbauer [PDF 1.1 MB] - Wirtschaft](https://img.yumpu.com/47061208/1/190x143/prasentation-von-h-hofbauer-pdf-11-mb-wirtschaft.jpg?quality=85)








![Präsentation von B. Häfliger [PDF 2.2 MB] - Wirtschaft](https://img.yumpu.com/15397699/1/190x135/prasentation-von-b-hafliger-pdf-22-mb-wirtschaft.jpg?quality=85)
