Stimmengewirr oder Dialog? - Bakom - CH
Stimmengewirr oder Dialog? - Bakom - CH
Stimmengewirr oder Dialog? - Bakom - CH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Kommunikativer Respekt <strong>oder</strong> wie höflich die AkteurInnen miteinander sprechen<br />
Fall. Erstaunlich ist, dass die M<strong>oder</strong>ation der öffentlichen Sender mehr als zweimal so oft<br />
erfolglos versucht, das Rederecht zu übernehmen als bei den privaten. Die Sprechenden<br />
können sich jedoch nicht frei am Diskurs beteiligen, wenn sie häufig darauf bedacht sein<br />
müssen, das Rederecht zu verteidigen. Von diesem Standpunkt aus betrachtet, sind die<br />
Sendungen der Privaten kooperativer. Allerdings müssen die Interruptionen, also die geglückten<br />
Gesprächsschrittübernahmen, ebenfalls in Betracht gezogen werden. Dabei<br />
schneiden die Privaten deutlich schlechter ab als die Öffentlichen. Rein rechnerisch überwiegen<br />
die Formen des respektverletzenden Verhaltens in den Sendungen der privaten<br />
Anbieter ganz leicht (Unterschied: 3%). Bedenkt man indes, dass die Debatten – bei denen<br />
das Antasten des Rederechts begründeterweise vermehrt erwartet werden kann – in den<br />
privaten Sendern ein grösseres Gewicht einnehmen, sprechen die Ergebnisse dafür, dass<br />
der Diskurs in bei den öffentlichen Anbieter weniger respektvoll verläuft. Ein weiteres<br />
Indiz hierfür sind die jeweils angewandten Formen der Gegenstrategie (s.u.).<br />
Auf Ebene der Sprachregionen kann festgehalten werden, dass die Diskussionen in der<br />
Romandie aufgeriebener sind als in der Deutschschweiz. Die Resultate bezüglich der realisierten<br />
Unterbrechung deuten ebenfalls daraufhin, wird doch in der französischsprachigen<br />
Schweiz dem Gegenüber öfter ins Wort gefallen und das Rederecht übernommen als in der<br />
Deutschschweiz.<br />
8.1.3 Gegenstrategien zur Behauptung des Rederechts<br />
Häufig wird von den AkteurInnen eine Rückmeldung dazu benutzt, den Gesprächsschritt<br />
selbst zu übernehmen. Im vorangehenden Subkapitel wurde ausgeführt, wie oft versucht<br />
wird, den/die aktuelle/n SprecherIn zu unterbrechen, diese/r das Rederecht aber nicht abgibt<br />
und mit dem Gesprächsschritt weiterfährt. Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang<br />
stellt ist, welche Gegenstrategien zur Behauptung des Rederechts angewandt werden.<br />
Dabei interessiert vor allem, inwiefern die Beteiligten durch Metakommunikation explizit<br />
sagen, dass sie sich durch die Unterbrechung gestört fühlen.<br />
Ein/e Sprechende/r, dem/der das Rederecht aberkannt werden soll, kann sich auf verschiedene<br />
Arten zur Wehr setzen: (1) Er/sie spricht lauter, um den Unterbrechungsversuch zu<br />
übertönen <strong>oder</strong> spricht einfach weiter. (2) Er/sie wiederholt den unterbrochenen Redeteil<br />
noch einmal, vielleicht sogar mehrmals und versucht auf diese Weise zu erreichen, dass<br />
der/die UnterbrecherIn wieder schweigt. (3) Durch die dritte Gegenstrategie thematisiert<br />
der/die aktuelle SprecherIn die Unterbrechung als solches und wehrt sich explizit, indem<br />
er/sie auf die Wahrung der geltenden Diskursnormen hinweist.<br />
Klassische Medien: M<strong>oder</strong>ation und Gesprächsteilnehmende<br />
Zunächst interessiert, ob die M<strong>oder</strong>ation die versuchten Unterbrechungen anders abwehrt<br />
als die Teilnehmenden. Folgende Grafik zeigt die verschiedenen Strategien zur Behauptung<br />
des Rederechts in den klassischen Medien.<br />
177


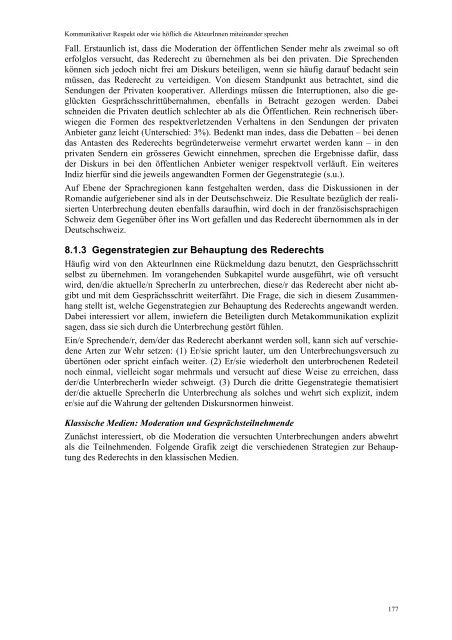



![Präsentation von H. Hofbauer [PDF 1.1 MB] - Wirtschaft](https://img.yumpu.com/47061208/1/190x143/prasentation-von-h-hofbauer-pdf-11-mb-wirtschaft.jpg?quality=85)








![Präsentation von B. Häfliger [PDF 2.2 MB] - Wirtschaft](https://img.yumpu.com/15397699/1/190x135/prasentation-von-b-hafliger-pdf-22-mb-wirtschaft.jpg?quality=85)
