Stimmengewirr oder Dialog? - Bakom - CH
Stimmengewirr oder Dialog? - Bakom - CH
Stimmengewirr oder Dialog? - Bakom - CH
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Fazit: <strong>Stimmengewirr</strong> <strong>oder</strong> <strong>Dialog</strong>?<br />
mente der GesprächspartnerInnen ein als die Teilnehmenden. Dies, obschon mit vielen<br />
Aufgaben der Gesprächsleitung wie Wortmeldungen sammeln, Denkimpulse geben <strong>oder</strong><br />
das Rederecht verteilen eher eine oberflächliche Bezugnahme verbunden ist. Aus Sicht der<br />
RezipientInnen ist diese Aktivität positiv zu werten, hilft sie doch, einzelne Argumente<br />
zueinander in Bezug zu setzen. Im Fernsehen, wo sich oftmals mehrere AkteurInnen gegenüberstehen,<br />
da mehr Debatten als Interviews ausgestrahlt wurden, erlangt dieses Gesprächsverhalten<br />
auch etwas grössere Bedeutung. Was den kritisch reflektierten Umgang<br />
mit dem Gesagten angeht, fällt das Ergebnis indes weniger positiv aus. Die M<strong>oder</strong>ation ist<br />
eher selten darum bemüht, die vorgebrachten Geltungsansprüche auf deren Plausibilität hin<br />
zu prüfen. Diese aus Sicht der Deliberation zentrale Aufgabe wird von den Teilnehmenden<br />
zwar ebenfalls nur begrenzt wahrgenommen, aber immerhin stärker als von den M<strong>oder</strong>atorInnen.<br />
Diese stellen in den untersuchten Sendungen eher provokative Fragen, bedienen<br />
sich jeweils oppositioneller Meinungen, um mögliche Einwände zu formulieren und sind<br />
darum bemüht, die Teilnehmenden zu klaren Positionierungen zu bewegen. Allerdings<br />
konnte bezüglich des kritisch reflektierten Gesprächsverhaltens eine relativ hohe Varianz<br />
zwischen einzelnen Sendungen ausgemacht werden. Das Sendekonzept scheint hier also<br />
eine entscheidende Rolle zu spielen. Auf Ebene der Anbieter konnten diesbezüglich ebenfalls<br />
geringfügige Unterschiede festgestellt werden. Die M<strong>oder</strong>atorInnen greifen im öffentlichen<br />
Radio und Fernsehen etwas stärker in die Diskussion ein, indem sie die Argumentation<br />
kritisch beleuchten. Der Unterschied ist jedoch eher gering. Wiederum als generelles<br />
Ergebnis formuliert, hat sich gezeigt, dass die M<strong>oder</strong>atorInnen ihre Geltungsansprüche in<br />
der Mehrheit nicht begründen, was mit der von ihnen eingenommenen Rolle als Gesprächsleiterin<br />
zusammenhängt.<br />
Aus Sicht der Diskursqualität käme der M<strong>oder</strong>ation die Aufgabe zu, dafür zu sorgen, dass<br />
eine respektvolle Interaktion möglich ist. Eine Aufgabe, die – ordnet man das dialogische<br />
Format dem Bereich „Infotainment“ zu – dem Faktor „Unterhaltung“ zuwider läuft. Ein<br />
Indikator für die Frage, ob diese Aufgabe wahrgenommen wird, ist, ob die Diskussion in<br />
geordneten Bahnen verläuft <strong>oder</strong> ob vielmehr eine hitzige Auseinadersetzung stattfindet, in<br />
der sich die GesprächsteilnehmerInnen gegenseitig ins Wort fallen und mitunter beleidigend<br />
werden. Im Vergleich zu den Teilnehmenden verhält sich die M<strong>oder</strong>ation in den untersuchten<br />
Sendungen respektvoller: Sie unterbricht die Sprechenden insgesamt zwar häufiger,<br />
wahrt aber in der Hälfte aller Fälle bestehende Diskursnormen, indem die Unterbrechungen<br />
der Verständigung dienen (akustisch <strong>oder</strong> inhaltlich), explizit entschuldigt werden<br />
<strong>oder</strong> dadurch begründet sind, dass die Aufgabe der M<strong>oder</strong>ation vorsieht, das Rederecht<br />
ausgeglichen zu verteilen. Ebenso fällt sie im Vergleich zu den anderen Diskursteilnehmenden<br />
weniger dadurch auf, dass sie das Gesagte gewissermassen aus dem Off kommentieren<br />
<strong>oder</strong> den Sprechenden ins Wort fallen ohne im Anschluss daran auch einen Beitrag<br />
zur Diskussion leisten zu können. Versucht die M<strong>oder</strong>ation das Rederecht zu übernehmen,<br />
gelingt ihr dies häufiger als den Teilnehmenden, was dem beschriebenen Übernahme-<br />
Privileg geschuldet ist. Da die übrigen Teilnehmenden jedoch verstärkt den kommunikativen<br />
Respekt verletzen, kann also nicht davon gesprochen werden, dass die M<strong>oder</strong>ation ein<br />
respektvolles Diskursklima zu schaffen versteht. Eine mangelnde Bemühung diesbezüglich<br />
kann daran abgelesen, dass sie kaum eine Metakommunikation anregt, in der das Respektieren<br />
des Rederechts zur Diskussion steht. Während die M<strong>oder</strong>ation selber äusserst selten<br />
beleidigend wird, ist dieses Gesprächsverhalten bei den Teilnehmenden doch öfters festzustellen.<br />
192<br />
Von Interesse ist diesbezüglich auch die Frage, von wem und in welchem Masse der Diskurs<br />
personalisiert wird. Der „Infotainment“-Charakter der Sendungen wird vornehmlich<br />
192 Das mag auf konversationsanalytischer Ebene auch damit zusammenhängen, dass das Diskursverhalten<br />
der M<strong>oder</strong>ation von den anderen Teilnehmenden als konstitutiver Bestandteil der Rolle „M<strong>oder</strong>ation“ gesehen<br />
wird und daher keine „Vorbild-Funktion“ erfüllt, an der sich die DiskutantInnen orientieren.<br />
219


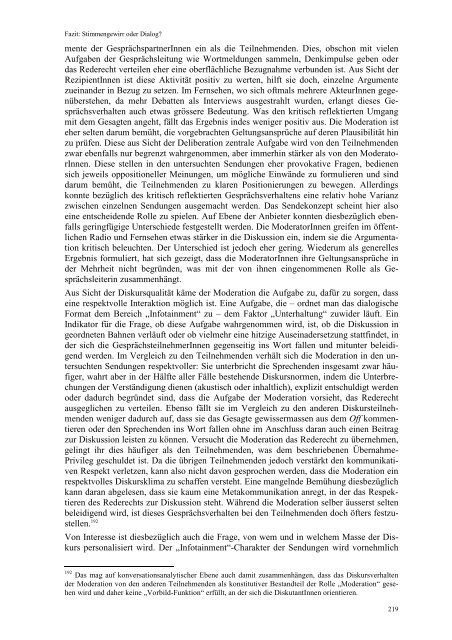



![Präsentation von H. Hofbauer [PDF 1.1 MB] - Wirtschaft](https://img.yumpu.com/47061208/1/190x143/prasentation-von-h-hofbauer-pdf-11-mb-wirtschaft.jpg?quality=85)








![Präsentation von B. Häfliger [PDF 2.2 MB] - Wirtschaft](https://img.yumpu.com/15397699/1/190x135/prasentation-von-b-hafliger-pdf-22-mb-wirtschaft.jpg?quality=85)
