Stimmengewirr oder Dialog? - Bakom - CH
Stimmengewirr oder Dialog? - Bakom - CH
Stimmengewirr oder Dialog? - Bakom - CH
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Reziprozität <strong>oder</strong> ob die AkteurInnen wirklich miteinander sprechen<br />
Unterkapitel auf den Sprecherwechsel eingegangen, danach wird anhand der verschiedenen<br />
Untersuchungsebenen analysiert, wie stark sich die AkteurInnen aufeinander beziehen.<br />
6.1 Sprecherwechsel <strong>oder</strong> wie das Wort übergeben wird<br />
Der Begriff „idealer Rollenwechsel“ beschreibt, dass die AkteurInnen die Rolle als SprecherIn<br />
sowie als HörerIn einnehmen und zwischen diesen Rollen wechseln. Nehmen sie<br />
nur eine Rolle ein, ist dies ein Indiz dafür, dass der Diskurs systematisch verzerrt ist. In<br />
den massenmedialen Formaten der traditionellen elektronischen Medien sind sowohl der<br />
Diskurs als auch die Rollen bereits zu einem gewissen Grad institutionalisiert (vgl. Clayman,<br />
Heritage 2002). Bei Radio und Fernsehen gehört es zur Aufgabe des/der M<strong>oder</strong>atorIn<br />
dafür zu sorgen, dass es zu keiner Verzerrung des Gesprächs kommt. Im Internet dagegen<br />
hängt es von der Fähigkeit der AkteurInnen ab, den Diskurs selbst zu regulieren. Es kann<br />
nicht davon ausgegangen werden, dass ein/e DiskursteilnehmerIn die Rolle der Diskussionsleitung<br />
übernehmen kann und in dieser Funktion von allen akzeptiert wird. Daher kann<br />
bei diskursiver Dominanz nur versucht werden, mittels Ausgrenzungsstrategien anderen<br />
Teilnehmenden das Kommunikationsrecht abzusprechen. 116<br />
Grundeinheit des Gesprächs ist der Gesprächsschritt, also der Redebeitrag bzw. das Post.<br />
Mit jedem Rede- bzw. Forumsbeitrag kommen die Teilnehmenden der Rolle als SprecherIn<br />
nach, den Gesprächsschritten anderer folgen sie potentiell als HörerInnen. Inwiefern sie<br />
diese Rolle einnehmen, kann ermittelt werden, indem untersucht wird, wie oft sie sich auf<br />
das Gesagte beziehen. Wie stark sich jemand in der Rolle als SprecherIn in die Diskussion<br />
einbringt, kann – wie in Kapitel 5 bereits behandelt – stark differieren.<br />
Der Sprecherwechsel ist eine Voraussetzung für das Zustandekommen eines <strong>Dialog</strong>s. Denn<br />
<strong>Dialog</strong>e, „in denen kein Sprecherwechsel mehr vorkommt, sind eben keine <strong>Dialog</strong>e mehr“<br />
(Schwitalla 1979: 54). Der Sprecherwechsel bezeichnet also das für ein Gespräch konstitutive<br />
Wechseln von der Hörer- in die Sprecherrolle. Er ist damit die „zentrale Schaltstelle<br />
des Gesprächs“ und beantwortet die Frage, wie die GesprächsteilnehmerInnen nacheinander<br />
zu Wort kommen, ohne dass ein verbales Durcheinander entsteht (Linke et al. 2004:<br />
300). Der Sprecherwechsel ist damit charakteristisch für das Gespräch. Dessen verschiedene<br />
Formen lassen Aussagen über die Eigenschaften des Gesprächs zu. Bei einem Interview<br />
ist der Rollenwechsel leichter vorherzusehen als in einer Diskussion, in der einem/r SprecherIn<br />
mehrere HörerInnen gegenüberstehen. Es steht folglich nicht unbedingt immer fest,<br />
wer als nächstes das Wort ergreifen wird. Hier interessiert also die Art, wie dieser Rollenwechsel<br />
zustande kommt; es geht um die Organisationsform des Gesprächs. Zu diesem<br />
Zweck wurde für jeden Redebeitrag bzw. Post erhoben, wie die Sprecherrolle übernommen<br />
worden ist. Es können zwei Fälle unterschieden werden: Der/die augenblickliche SprecherIn<br />
wurde vom/von der vorangegangenen SprecherIn als neue/r RednerIn bestimmt<br />
(Fremdwahl) <strong>oder</strong> der/die aktuelle SprecherIn beginnt den Gesprächsschritt von sich aus,<br />
hat also das Gespräch eigeninitiativ übernommen (Selbstwahl) (vgl. dazu Linke et al. 2004:<br />
301). Bei der Fremdwahl wird bei den klassischen Medien zudem unterschieden, wer das<br />
Wort erteilt hat, die M<strong>oder</strong>ation <strong>oder</strong> ein/e ander/e AkteurIn.<br />
Sprecherwechsel in den klassische Medien<br />
Die Sprechenden können sich an zwei Grundregeln des Gesprächs orientieren: Erstens, es<br />
spricht jeweils nur ein/e GesprächsteilnehmerIn und zweitens, jene Person, die nach einem<br />
Gesprächsbeitrag als erste das Wort ergreift, hat das Anrecht auf den Redebeitrag (vgl.<br />
116 Vgl. Kapitel 5.2 und 8.2, S. 79ff. bzw. 187ff. Wie Davis (1999) aufzeigt, sind solche Ausgrenzungs-<br />
Strategien in Online-Foren durchaus an der Tagesordnung. Sie betreffen indes nicht nur den Disput zwischen<br />
Teilnehmenden mit unterschiedlichen Meinungen, sondern sind ebenso ein Merkmal des Umgangs zwischen<br />
„etablierten“ DiskursteilnehmerInnen und „Neulingen“ (vgl. Davis 1999: 149ff.).<br />
99


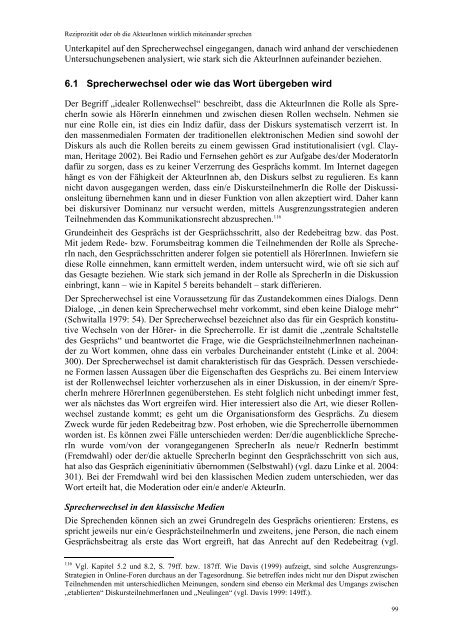



![Präsentation von H. Hofbauer [PDF 1.1 MB] - Wirtschaft](https://img.yumpu.com/47061208/1/190x143/prasentation-von-h-hofbauer-pdf-11-mb-wirtschaft.jpg?quality=85)








![Präsentation von B. Häfliger [PDF 2.2 MB] - Wirtschaft](https://img.yumpu.com/15397699/1/190x135/prasentation-von-b-hafliger-pdf-22-mb-wirtschaft.jpg?quality=85)
