Stimmengewirr oder Dialog? - Bakom - CH
Stimmengewirr oder Dialog? - Bakom - CH
Stimmengewirr oder Dialog? - Bakom - CH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Fazit: <strong>Stimmengewirr</strong> <strong>oder</strong> <strong>Dialog</strong>?<br />
häufiger zu Wort, wodurch die stärkere Repräsentanz der BefürworterInnen in der klassisch<br />
medialen Arena kompensiert wird. Womöglich ist dies auf eine Dominanz befürwortender<br />
Stimmen auch in der nicht-medialen Öffentlichkeit zurückzuführen, denn beide Abstimmungen<br />
wurden in der Romandie deutlicher angenommen als in der Deutschschweiz.<br />
Für eine abschliessende Beurteilung müsste diesbezüglich allerdings auch die Medienleistung<br />
in den Printmedien und den monologischen Formaten von Radio und Fernsehen hinzugezogen<br />
werden.<br />
Hinsichtlich der Art und Weise wie der <strong>Dialog</strong> geführt wird, lassen sich in Bezug auf die<br />
Frage, wer das Wort ergreift und wer wen zum Sprechen/Schreiben auffordert keine Besonderheiten<br />
feststellen, die nicht auf die unterschiedliche Gewichtung jeweiliger <strong>Dialog</strong>formate<br />
bzw. auf die Forumsstruktur zurückzuführen sind. Gleiches gilt für die Frage wie<br />
stark sich die Teilnehmenden aufeinander beziehen. Die Diskurskultur in der Deutschschweiz<br />
unterscheidet sich von derjenigen im französischsprachigen Landesteil jedoch<br />
dahingehend, als der <strong>Dialog</strong> hier insgesamt kritischer ausgerichtet ist. Die trifft sowohl auf<br />
die klassischen Medien zu, für die das Ergebnis allerdings mit jenem für das <strong>Dialog</strong>format<br />
der Debatte korreliert, als auch für die Online-Foren. In den deutschsprachigen Online-<br />
Foren baz.ch, espace.ch und google.groups.ch zielen rund die Hälfte aller Geltungsansprüche<br />
auf eine Kritik, in den Westschweizer Foren tdg.ch und 24.heures.ch ist dies im Schnitt<br />
nur bei jedem vierten Geltungsanspruch der Fall. Das Ergebnis deutet deshalb in der Tendenz<br />
auf unterschiedliche Gesprächskulturen in den beiden Sprachregionen hin. Offenbar<br />
geht es den Teilnehmenden in den dialogischen Formaten der Westschweiz eher darum,<br />
Sachverhalte und eigene Meinungen darzulegen als das Gesagte zu kritisieren. Bei den<br />
übrigen Vergleichsebenen ging ein hohes Mass an Kritik meist mit einer weniger respektvollen<br />
Interaktion einher. Im sprachregionalen Vergleich bestätigt sich ein solcher Zusammenhang<br />
nur bedingt. Das Mass an beleidigenden Äusserungen ist in der Deutschschweiz<br />
zwar tatsächlich höher lässt sich jedoch für die klassischen Medien auf den stärkeren<br />
Einfluss der Debatten zurückführen. Aus dieser Perspektive hätten die Unterschiede<br />
sogar noch deutlicher ausfallen müssen. In den Online-Foren sind es v.a. die google.groups<br />
die dadurch auffallen, dass die Teilnehmenden mit ihren Äusserungen auf die Integrität<br />
Anderer abzielen und lediglich in die Ergebnisse der Deutschschweiz Eingang finden. Ein<br />
weiterer Gradmesser für den kommunikativen Respekt in den klassischen Medien bildet<br />
das Mass an (versuchten) Unterbrechungen. Anders als das höhere Mass an Kritik und das<br />
stärkere Gewicht der Debatten in der Deutschschweiz hätten erwarten lassen, ist die Kommunikation<br />
in der deutschsprachigen Schweiz diesbezüglich deliberativer: Die Teilnehmenden<br />
unterbrechen sich seltener und attackieren das Rederecht Anderer weniger als in<br />
der Romandie. Des Weiteren gehen die Sprechenden in den beiden Sprachregionen mit den<br />
versuchten Interruptionen etwas anders um: In der Deutschschweiz nimmt die Metakommunikation<br />
über das Verletzten geltender Diskursnormen ein leicht stärkeres Gewicht ein.<br />
In der Romandie gehen die AkteurInnen demnach zwar aus kommunikativer Sicht gesehen<br />
respektloser miteinander um, berufen sich jedoch auch seltener auf die Anwendung geltender<br />
Diskursregeln. Ob dies auf eine höhere Sensibilisierung auf (versuchte) Unterbrechungen<br />
als normwidriges Verhalten in der Deutschschweiz zurückzuführen ist <strong>oder</strong> auf das<br />
vorherrschende <strong>Dialog</strong>format, kann an dieser Stelle nicht abschliessend geklärt werden.<br />
Bezogen auf die Kommunikationsinhalte korreliert das höhere Mass an beleidigenden Äusserungen<br />
in der Deutschschweiz mit einer generell stärker personalisierten Debatte. Wiederum<br />
dürfte das <strong>Dialog</strong>format bei den klassischen Medien diesbezüglich eine Einflussgrösse<br />
darstellen, während bei den Online-Foren von einer unterschiedlichen Diskurskultur<br />
auf einzelnen Plattformen ausgegangen werden muss. Demgegenüber stehen Geltungsansprüche<br />
auf der subjektiven Ebene in der Romandie verstärkt im Zusammenhang mit der<br />
Lebenswelt der AkteurInnen. Die lebensweltliche Perspektive findet im direkten Vergleich<br />
sowohl in den klassischen Medien als insbesondere auch in den Online-Foren der Westschweiz<br />
mehr Berücksichtigung. Während die Ergebnisse in Radio und Fernsehen allen-<br />
217


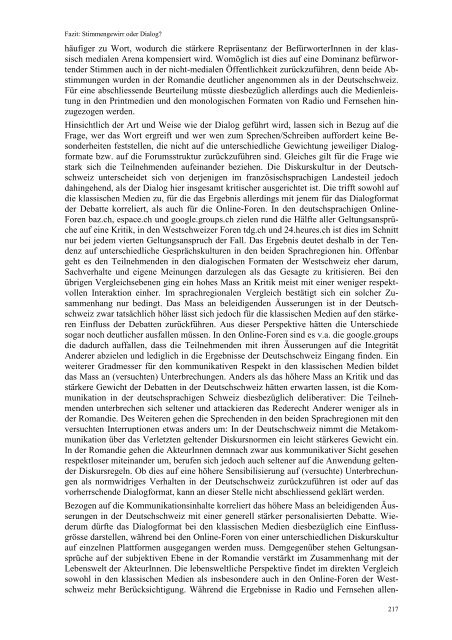



![Präsentation von H. Hofbauer [PDF 1.1 MB] - Wirtschaft](https://img.yumpu.com/47061208/1/190x143/prasentation-von-h-hofbauer-pdf-11-mb-wirtschaft.jpg?quality=85)








![Präsentation von B. Häfliger [PDF 2.2 MB] - Wirtschaft](https://img.yumpu.com/15397699/1/190x135/prasentation-von-b-hafliger-pdf-22-mb-wirtschaft.jpg?quality=85)
