Stimmengewirr oder Dialog? - Bakom - CH
Stimmengewirr oder Dialog? - Bakom - CH
Stimmengewirr oder Dialog? - Bakom - CH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Theoretische Verortung der Untersuchung<br />
munikative Rationalität und die darin begründeten formalpragmatischen Universalien sind<br />
also die Voraussetzungen politischen Handelns und nicht etwa deren Anhängsel.<br />
Freilich fehlen in Cohen’s Modell wichtige interne Differenzierungen sowie die Antwort<br />
auf die Frage, wie das deliberative Verfahren gesamtgesellschaftlich institutionalisiert bzw.<br />
einzelne deliberative Arenen miteinander verknüpft werden müssen, damit sich politische<br />
Entscheidungen legitimieren lassen (vgl. Habermas 1992, s.u.). Diese Differenzierungen<br />
und Erweiterungen des deliberativen Verfahrens von einer individuellen Praxis auf einen<br />
die gesamte Gesellschaft durchdringenden Kommunikationskreislauf legt Jürgen Habermas<br />
1992 in „Faktizität und Geltung“ vor, worin diskurstheoretische Untersuchungen der<br />
Demokratie mit einer prozeduralen Konzeption von (politischer) Öffentlichkeit verknüpft<br />
werden (vgl. Habermas 1992). 10 In der Folge situiert Habermas deliberative Demokratie<br />
nicht nur wie Cohen als eine institutionelle Praxis, sondern als ein eigenständiges normatives<br />
Modell in der politischen Theorie, das zwischen Liberalismus einerseits und Republikanismus<br />
andererseits zu liegen kommt (Habermas 1996). Mit beiden Modellen teilt es<br />
gewisse Aspekte, grenzt sich von ihnen aber dezidiert auch da ab, wo Habermas Probleme<br />
mit der liberalen bzw. der republikanischen Konzeption von Politik ausmacht. 11 Damit<br />
wird das Modell deliberativer Demokratie aber nicht lediglich eine ideale Schnittmenge<br />
von Liberalismus und Republikanismus, sondern geht klar darüber hinaus, wie im Folgenden<br />
gezeigt werden soll.<br />
In einer idealtypischen Konzeption des Liberalismus übernimmt Politik die Vermittlung<br />
gebündelter privater Interessen gegenüber dem Staat, der seinerseits weitestgehend auf<br />
seine administrativen Funktionen beschränkt ist. Nach republikanischer Auffassung geht<br />
dieses Modell indes nicht weit genug, da Politik gleichbedeutend ist mit dem Vergesellschaftungsprozess<br />
im Ganzen. Der Republikanismus entwirft gegenüber dem liberalen<br />
Ideal demnach eine Kommunikationsgemeinschaft, die sich selber organisiert und in der<br />
die Politik die Rolle eines ethischen Selbstverständigungsprozesses einnimmt, der seinerseits<br />
von einem eingespielten Hintergrundkonsens und der Solidarität der Mitglieder der<br />
Gemeinschaft getragen wird. Meinungs- und Willensbildung konstituieren im Republikanismus<br />
das politische Gemeinwesen, im Liberalismus legitimieren sie lediglich die Ausübung<br />
politischer Macht. Neben der administrativen Macht des Staates und dem Eigeninteresse<br />
der Privatpersonen wird die Solidarität der Zivilgesellschaft so zur dritten Kraft gesellschaftlicher<br />
Integration. Mehr noch als im Liberalismus nimmt hier die politische Öffentlichkeit<br />
eine entscheidende Position ein.<br />
Obwohl Habermas die Kritik am Liberalismus in vielen Bereichen teilt, macht er auch<br />
Vorbehalte gegenüber der republikanischen Alternative geltend. Diese richten sich hauptsächlich<br />
gegen die idealistischen Grundannahmen des Republikanismus, der „den demokratischen<br />
Prozess von den Tugenden gemeinwohlorientierte Staatsbürger abhängig macht.<br />
[…] Politik besteht nicht nur, und nicht einmal in erster Linie, aus Fragen der ethischen<br />
Selbstverständigung“ (Habermas 1996: 283, Hervorhebung i.O.). Aus deliberativer Sicht<br />
stellen ethische Selbstverständigungsdiskurse lediglich einen Bereich der Politik dar, zu<br />
denen insbesondere moralische Gerechtigkeitsdiskurse wie auch pragmatische Verhandlungsdiskurse<br />
hinzutreten. Die Diskurstheorie der Demokratie knüpft zwar am republikanischen<br />
Modell an, indem auch unter deliberativen Aspekten den kollektiven Meinungs- und<br />
Willensbildungsprozessen das Hauptinteresse gilt. Nur werden diese nicht als der Aus-<br />
10 Alternative Konzeptionen stellen etwa Rawls „Political Liberalism“ dar, dann aber auch die als „Differenz-Demokratie“<br />
bezeichneten Modelle von Laclau und Mouffe (1991) <strong>oder</strong> Sanders (1996), wie auch das<br />
substantivistische Modell von Gutmann und Thompson (1996, 2004), die neben reinen Verfahrensnormen<br />
auch substantielle Aspekte in ihr Modell aufnehmen.<br />
11 Dabei stellt er klar, dass er seinen eigenen Ansatz zwei stark zugespitzten Formen des Liberalismus bzw.<br />
des Republikanismus gegenüber stellt, um die entscheidenden Unterschiede besser verdeutlichen zu können<br />
(vgl. Habermas 1996).<br />
15


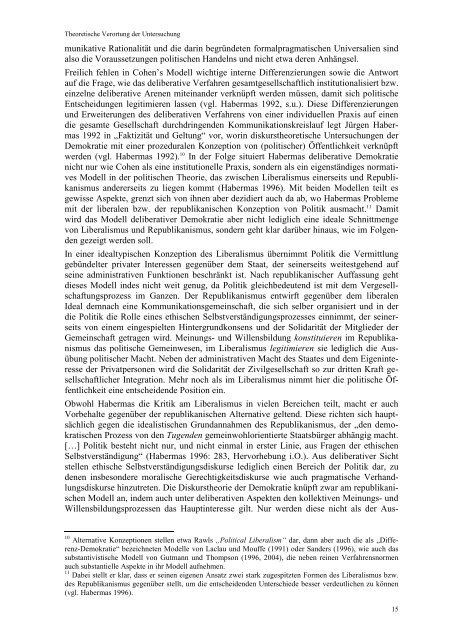



![Präsentation von H. Hofbauer [PDF 1.1 MB] - Wirtschaft](https://img.yumpu.com/47061208/1/190x143/prasentation-von-h-hofbauer-pdf-11-mb-wirtschaft.jpg?quality=85)








![Präsentation von B. Häfliger [PDF 2.2 MB] - Wirtschaft](https://img.yumpu.com/15397699/1/190x135/prasentation-von-b-hafliger-pdf-22-mb-wirtschaft.jpg?quality=85)
