Stimmengewirr oder Dialog? - Bakom - CH
Stimmengewirr oder Dialog? - Bakom - CH
Stimmengewirr oder Dialog? - Bakom - CH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Methodische Umsetzung der Analyse<br />
der diese aufgestellt hat. 59 Das Argumentum ad hominem wurde ebenfalls pro Geltungsanspruch<br />
codiert.<br />
Da eine Grundbedingung der politischen Meinungs- und Willensbildung die Auseinandersetzung<br />
mit dem jeweiligen Politikum ist – unabhängig davon, ob dies aus der sachlichen,<br />
normativen <strong>oder</strong> subjektiven Perspektive geschieht – wurde jeder Geltungsanspruch zudem<br />
entweder als themenrelevant <strong>oder</strong> themenfremd codiert.<br />
Begründung von Geltungsansprüchen<br />
Zielt die Reziprozität auf den Einbezug des vorab Geäusserten ab, so handelt es sich bei<br />
der Begründung der Geltungsansprüche um die Rationalität des Diskurses und zwar bezogen<br />
auf die eigene Position. Das heisst, es geht in erster Linie darum, ob der erhobene bzw.<br />
kritisierende Geltungsanspruch im Weiteren auch begründet wird <strong>oder</strong> unbegründet stehen<br />
bleibt („Ich bin für einen Beitritt zum Schengener Abkommen, denn es gibt uns die Möglichkeit,<br />
Sicherheitsfragen auf einer gesamteuropäischen Ebenen zu koordinieren. Der Nationalstaat<br />
– und das wissen wir alle – kann diese Herausforderungen allein nicht mehr<br />
lösen“).<br />
Jeder Geltungsanspruch wird als begründet <strong>oder</strong> unbegründet klassifiziert. 60 Die Codierung<br />
wurde wiederum gewichtet vorgenommen, d.h. wenn einzelne Sprechakte innerhalb eines<br />
Geltungsanspruchs begründet waren, andere hingegen nicht, so war der dominierende Teil<br />
entscheidend für die entsprechend Zuordnung. Die Plausibilität der Begründung steht bei<br />
dieser Kategorie nicht im Vordergrund, denn zum einen ist es aus forschungsökonomischen<br />
Gründen nicht zu bewerkstelligen, den Gehalt einer Begründung zu ermitteln. Zum<br />
zweiten ist es – berücksichtigt man die Perspektive der RezipientInnen – auch nicht angezeigt,<br />
Begründungen in Abrede zu stellen, die zwar nicht plausibel sind, aber als solche<br />
wahrgenommen werden. Dies insbesondere, weil es sich beim Untersuchungsgegenstand<br />
um spontane Sprache handelt und dem Publikum bei den klassischen Medien nur eine begrenzte<br />
Zeit zur kognitiven Verarbeitung des Gesagten zur Verfügung steht. Offensichtliche<br />
Zirkelschlüsse wurden indes nicht als Begründung gewertet („es ist gut, weil es gut<br />
ist“). Eine darüber hinausgehende Analyse bezüglich der Frage, ob eine Begründung<br />
schlüssig ist, wurde nicht vorgenommen. Dies insbesondere auch deshalb, weil der deliberative<br />
Ansatz es nahe legt, die Perspektive der Teilnehmenden einzunehmen. Gefragt wird<br />
also nicht nach der Gültigkeit einer Begründung in argumentationstheoretischen Termini,<br />
59 Einige Beispiele: In einer Sendung „Forums“ (RSR1) dreht sich die Diskussion um Personenkontrollen.<br />
Oscar Freysinger äussert die Befürchtung, dass in Zukunft alle ihre Identitätskarten auf sich tragen müssen.<br />
Die M<strong>oder</strong>ation wirft ein, dass dies heute schon der Fall sei. Freysinger verneint, er trage sie nicht die ganze<br />
Zeit mit sich herum. Darauf die M<strong>oder</strong>ation: „Parce que vos êtes connu Monsieur Freysinger. Vous êtes un<br />
star“ Hier steht nun die Person Freysingers im Vordergrund der Diskussion, nicht mehr das Thema der Personenkontrollen.<br />
?“ (Pascal Decaillet [M<strong>oder</strong>ation] in RSR1, „Forums“, 09.05.2005, 0:34:54). Ein weiteres<br />
Beispiel stammt aus der Teilsequenz ‚Der heisse Stuhl’ in der Sendung ‚Rundschau’ (SF DRS1): Das Interview<br />
mit Rita Fuhrer dreht sich um eine Rede Christoph Blochers in Rafz und die Situation an den Grenzen.<br />
Die M<strong>oder</strong>ation stellt folgende Frage: „Ich möchte aber noch einen Aspekt der Rede erwähnen. Sie wurden<br />
als Märtyrerin erwähnt, die im Kanton Zürich einen Maulkorb trägt. Fühlen Sie sich gebraucht“. Im Folgenden<br />
geht es um die Person Fuhrers. (Reto Brennwald [M<strong>oder</strong>ation] in SF DRS1, Rundschau, „Der heisse<br />
Stuhl“, 11.05.2005, 0:10:12).<br />
60 Steenbergen et al. (2003) gehen hier weiter, indem sie eine Abstufung definieren, die in vier Schritten von<br />
„no justification“ bis zur „sophisticated justification“ reicht. Im Rahmen des vorliegenden Projekts sind die<br />
Schattierungen der Begründung indes nicht ausschlaggebend für die Bestimmung des Diskursverlaufs bzw.<br />
dessen qualitative Ausgestaltung. Zudem ist das Code-Schema von Steenbergen et al. für Parlamentsdebatten<br />
entwickelt worden, d.h. es handelt sich hierbei grösstenteils um „geplante“ Aussagen, die dem geschriebenen<br />
Text sehr ähnlich sind. Gerade dies ist zumindest bei Radio und Fernsehen weitaus weniger der Fall. Daher<br />
wird hier zunächst eine einfachere Variante der Codierung vorgeschlagen, die gegebenenfalls weiter differenziert<br />
werden kann, sofern sie handhabbar bleibt.<br />
45


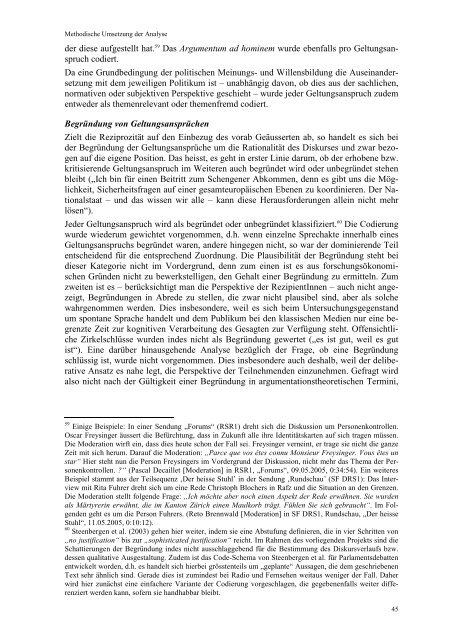



![Präsentation von H. Hofbauer [PDF 1.1 MB] - Wirtschaft](https://img.yumpu.com/47061208/1/190x143/prasentation-von-h-hofbauer-pdf-11-mb-wirtschaft.jpg?quality=85)








![Präsentation von B. Häfliger [PDF 2.2 MB] - Wirtschaft](https://img.yumpu.com/15397699/1/190x135/prasentation-von-b-hafliger-pdf-22-mb-wirtschaft.jpg?quality=85)
