Stimmengewirr oder Dialog? - Bakom - CH
Stimmengewirr oder Dialog? - Bakom - CH
Stimmengewirr oder Dialog? - Bakom - CH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Fazit: <strong>Stimmengewirr</strong> <strong>oder</strong> <strong>Dialog</strong>?<br />
schiedene Positionen als auch Akteursgruppen den <strong>Dialog</strong> untereinander und mit der M<strong>oder</strong>ation<br />
bestreiten.<br />
Diese grundsätzlich unterschiedliche Konstellation der Sprechenden hat Auswirkungen auf<br />
die Gesprächsorganisation und darauf, wie der Diskurs geführt wird. Die Abfolge der Redebeiträge<br />
ist in Interviews strukturierter als in Debatten, in denen sich mehrere Personen<br />
gegenüberstehen, die alle zu Wort kommen möchten. In Interviews ist der Sprecherwechsel<br />
durch die besondere Form des Gesprächs leichter vorhersehbar als in Debatten, in denen<br />
nicht immer feststeht, wer als nächstes das Wort ergreifen wird. Erwartungsgemäss ist<br />
die Rolle der M<strong>oder</strong>ation als Gesprächsleiterin in den Interviews ausgeprägter als in den<br />
Debatten. In Ersteren erfolgt die Worterteilung durch die M<strong>oder</strong>ation in gut der Hälfte aller<br />
Sprecherwechsel, in Letzteren wird das Gespräch noch deutlicher m<strong>oder</strong>iert, zu vier Fünfteln<br />
reagieren die Teilnehmenden hier in ihren Gesprächsschritten auf die M<strong>oder</strong>atorIn.<br />
Diesbezüglich schliesst die Frage an, ob sich die Teilnehmenden in den Interviews auch<br />
stärker auf die Äusserungen der GesprächspartnerInnen – in diesem Fall der M<strong>oder</strong>ation –<br />
beziehen. Tatsächlich nehmen die Teilnehmenden in Interviews, zumindest oberflächlich,<br />
etwas häufiger Bezug auf die M<strong>oder</strong>ation als das bei den Teilnehmenden in Debatten in<br />
Bezug auf alle AkteurInnen der Fall ist. Der Unterschied ist jedoch eher gering. Die M<strong>oder</strong>ation<br />
legt in beiden <strong>Dialog</strong>formaten ein ähnliches Gesprächsverhalten an den Tag, in den<br />
Interviews äussern die M<strong>oder</strong>atorInnen minimal mehr Redebeiträge, in denen überhaupt<br />
keine Bezugnahme erfolgt. Dies erstaunt insofern nicht, als in den tendenziell kürzeren und<br />
eng m<strong>oder</strong>ierten Interviewsendungen in der Regel ebenfalls verschiedene Aspekte eines<br />
Themas diskutiert werden, wobei eine Bezugnahme bei neuen Themensetzungen oftmals<br />
fehlt. Mit Blick auf die argumentative Bezugnahme, die für die Diskursqualität bestimmender<br />
ist, lassen sich bei der M<strong>oder</strong>ation zwischen den beiden <strong>Dialog</strong>formaten ebenfalls<br />
keine nennenswerten Unterschiede feststellen. Hingegen erfolgt eine tatsächliche Auseinandersetzung<br />
mit den Äusserungen Anderer durch die Teilnehmenden in den Debatten<br />
häufiger als in den Interviews. In der Tendenz greifen die Teilnehmenden in den Interviews<br />
die Aussagen der M<strong>oder</strong>ation auf der sprachlichen <strong>oder</strong> thematischen Ebene auf, um<br />
dann ihre Meinung vorzubringen ohne auf das Gesagte näher einzugehen. Die Unterschiede<br />
sind jedoch nicht besonders ausgeprägt. Das kommunikative Verhalten der Teilnehmenden<br />
weist auch in weiteren Aspekten darauf hin, dass ihnen im Interview viel Gelegenheit<br />
geboten wird, ihre Position darzulegen. Die Notwendigkeit, diese zu verteidigen,<br />
ist hingegen weniger gegeben, denn nur in einem Fünftel aller Geltungsansprüche wird<br />
Kritik geäussert. Wird Kritik geäussert, so ist diese mehrheitlich begründet. In den Debatten<br />
ist der Anteil an Kritik erwartungsgemäss höher und liegt in den untersuchten Sendungen<br />
für die Teilnehmenden bei knapp der Hälfte aller Geltungsansprüche. Dabei wird prozentual<br />
mehr unbegründete als begründete Kritik geäussert. Bezogen auf die Diskursqualität<br />
lassen die Ergebnisse punkto Begründung folgende Schlüsse zu: In Interviews begründen<br />
die AkteurInnen ihre Ansichten und Positionen in hohem Masse, eine kritisch reflektierte<br />
Auseinandersetzung mit dem Gesagten erfolgt indes kaum. In den Debatten werden<br />
die Äusserungen auf einen härteren Prüfstand gestellt, allerdings ist das Diskursklima insgesamt<br />
nicht besonders konstruktiv, da sowohl die eigenen Aussagen als auch die Kritik in<br />
einer leichten Mehrheit nicht begründet wird.<br />
Erwartungsgemäss ist der respektvolle Umgang miteinander in den Interviews ausgeprägter<br />
als in den Debatten. Da das Rederecht nicht gleichermassen kontestiert wird, werden<br />
die Sprechenden hier deutlich weniger oft unterbrochen als in Debatten, auch wird weniger<br />
oft (erfolglos) versucht, das Rederecht vorzeitig zu übernehmen. Die Notwendigkeit, auf<br />
mangelnden kommunikativen Respekt hinzuweisen ist entsprechend niedriger: Im Gegensatz<br />
zu den Debatten findet in Interviews keine Metakommunikation bezüglich dieses Aspekts<br />
statt. Entsprechend dazu werden in Debatten viermal häufiger despektierliche Äusserungen<br />
getätigt als in den Interviews. Nichts desto trotz ist in beiden <strong>Dialog</strong>formaten die<br />
208


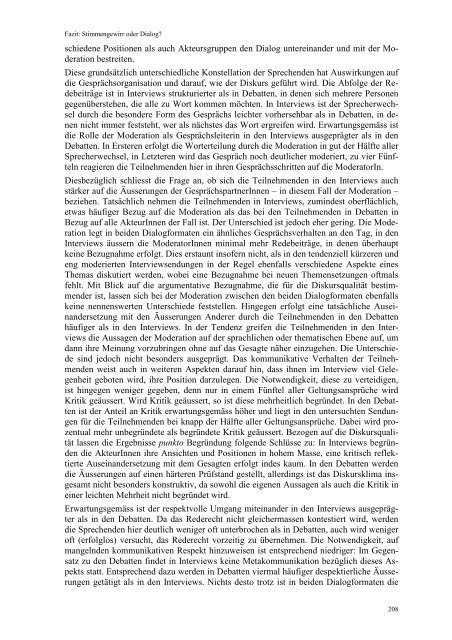



![Präsentation von H. Hofbauer [PDF 1.1 MB] - Wirtschaft](https://img.yumpu.com/47061208/1/190x143/prasentation-von-h-hofbauer-pdf-11-mb-wirtschaft.jpg?quality=85)








![Präsentation von B. Häfliger [PDF 2.2 MB] - Wirtschaft](https://img.yumpu.com/15397699/1/190x135/prasentation-von-b-hafliger-pdf-22-mb-wirtschaft.jpg?quality=85)
