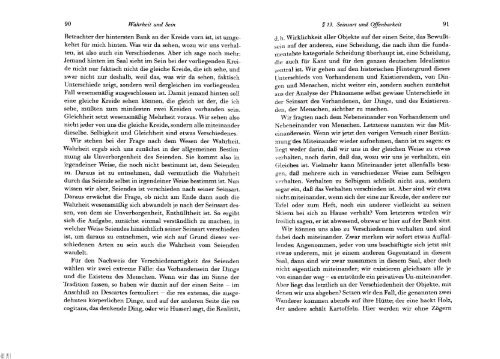Einleitung in die Philosophie - gesamtausgabe
Einleitung in die Philosophie - gesamtausgabe
Einleitung in die Philosophie - gesamtausgabe
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
111111111<br />
90 Wahrheit und Se<strong>in</strong><br />
Betrachter der h<strong>in</strong>tersten Bank an der Kreide vorn ist, ist umgekehrt<br />
für mich h<strong>in</strong>ten. Was wir da sehen, wozu wir uns verhalten,<br />
ist also auch e<strong>in</strong> Verschiedenes. Aber ich sage noch mehr:<br />
Jemand h<strong>in</strong>ten im Saal sieht im Se<strong>in</strong> bei der vorliegenden Kreide<br />
nicht nur faktisch nicht <strong>die</strong> gleiche Kreide, <strong>die</strong> ich sehe, und<br />
zwar nicht nur deshalb, weil das, was wir da sehen, faktisch<br />
Unterschiede zeigt, sondern weil dergleichen im vorliegenden<br />
Fall wesensmäßig ausgeschlossen ist. Damit jemand h<strong>in</strong>ten soll<br />
e<strong>in</strong>e gleiche Kreide sehen können, <strong>die</strong> gleich ist der, <strong>die</strong> ich<br />
sehe, müßten zum m<strong>in</strong>desten zwei Kreiden vorhanden se<strong>in</strong>.<br />
Gleichheit setzt wesensmäßig Mehrheit voraus. Wir sehen also<br />
nicht jeder von uns <strong>die</strong> gleiche Kreide, sondern alle mite<strong>in</strong>ander<br />
<strong>die</strong>selbe. Selbigkeit und Gleichheit s<strong>in</strong>d etwas Verschiedenes.<br />
Wir stehen bei der Frage nach dem Wesen der Wahrheit.<br />
Wahrheit ergab sich uns zunächst <strong>in</strong> der allgeme<strong>in</strong>en Bestimmung<br />
als Unverborgenheit des Seienden. Sie kommt also <strong>in</strong><br />
irgende<strong>in</strong>er Weise, <strong>die</strong> noch nicht bestimmt ist, dem Seienden<br />
zu. Daraus ist zu entnehmen, daß vermutlich <strong>die</strong> Wahrheit<br />
durch das Seiende selbst <strong>in</strong> irgende<strong>in</strong>er Weise bestimmt ist. Nun<br />
wissen wir aber, Seiendes ist verschieden nach se<strong>in</strong>er Se<strong>in</strong>sart.<br />
Daraus erwächst <strong>die</strong> Frage, ob nicht am Ende dann auch <strong>die</strong><br />
Wahrheit wesensmäßig sich abwandelt je nach der Se<strong>in</strong>sart dessen,<br />
von dem sie Unverborgenheit, Enthülltheit ist. So ergibt<br />
sich <strong>die</strong> Aufgabe, zunächst e<strong>in</strong>mal verständlich z~ machen, <strong>in</strong><br />
welcher Weise Seiendes h<strong>in</strong>sichtlich se<strong>in</strong>er Se<strong>in</strong>sart verschieden<br />
ist, um daraus zu entnehmen, wie sich auf Grund <strong>die</strong>ser verschiedenen<br />
Arten zu se<strong>in</strong> auch <strong>die</strong> Wahrheit vom Seienden<br />
wandelt.<br />
Für den Nachweis der Verschiedenartigkeit des Seienden<br />
wählen wir zwei extreme Fälle: das Vorhandense<strong>in</strong> der D<strong>in</strong>ge<br />
und <strong>die</strong> Existenz des Menschen. Wenn wir das im S<strong>in</strong>ne der<br />
Tradition fassen, so haben wir damit auf der e<strong>in</strong>en Seite - im<br />
Anschluß an Descartes formuliert - <strong>die</strong> res extensa, <strong>die</strong> ausgedehnten<br />
körperlichen D<strong>in</strong>ge, und auf der anderen Seite <strong>die</strong> res<br />
cogitans, das denkende D<strong>in</strong>g, oQer wie Husserl sagt, <strong>die</strong> Realität,<br />
§ 13. Se<strong>in</strong>sart und Offenbarkeit 91<br />
d. h. Wirklichkeit aller Objekte auf der e<strong>in</strong>en Seite, -das Bewußtse<strong>in</strong><br />
auf der anderen, e<strong>in</strong>e Scheidung, <strong>die</strong> nach ihm <strong>die</strong> fundamentalste<br />
kategoriale Scheidung überhaupt ist, e<strong>in</strong>e Scheidung,<br />
<strong>die</strong> auch für Kant und für den ganzen deutschen Idealismus<br />
zentral ist. Wir gehen auf den historischen fI<strong>in</strong>tergrund <strong>die</strong>ses<br />
Unterschieds von Vorhandenem und Existierendem, von D<strong>in</strong>gen<br />
und Menschen, nicht weiter e<strong>in</strong>, sondern suchen zunächst<br />
aus der Analyse der Phänomene selbst gewisse Unterschiede <strong>in</strong><br />
der Se<strong>in</strong>sart des Vorhandenen, der D<strong>in</strong>ge, und des Existierenden,<br />
der Menschen, sichtbar zu machen.<br />
Wir fragten nach dem Nebene<strong>in</strong>ander von Vorhandenem und<br />
Nebene<strong>in</strong>ander von Menschen. Letzteres nannten wir das Mite<strong>in</strong>anlierse<strong>in</strong>.<br />
Wenn wir jetzt den vorigen Versuch e<strong>in</strong>er Bestimmung'des<br />
Mite<strong>in</strong>ander wieder aufnehmen, dann ist zu sagen: es<br />
liegt weder dar<strong>in</strong>, daß wir uns <strong>in</strong> der gleichen Weise zu etwas<br />
verhalten, noch dar<strong>in</strong>, daß das, wozu wir uns je verhalten, e<strong>in</strong><br />
Gleiches ist. Vielmehr kann Mite<strong>in</strong>ander jetzt allenfalls besagen,<br />
daß mehrere sich <strong>in</strong> verschiedener Weise zum Selbigen<br />
verhalten. Verhalten zu Selbigem schließt nicht aus, sondern<br />
sogar e<strong>in</strong>, daß das Verhalten verschieden ist. Aber s<strong>in</strong>d wir etwa<br />
nicht mite<strong>in</strong>ander, wenn sich der e<strong>in</strong>e zur Kreide, der andere zur<br />
Tafel oder zum Heft, noch e<strong>in</strong> anderer vielleicht zu se<strong>in</strong>en<br />
Skiern, bei sich zu Hause verhält? Vom letzteren würden wir<br />
freilich sagen, er ist abwesend, obzwar er hier auf der Bank sitzt.<br />
Wir können uns also zu Verschiedenem verhalten und s<strong>in</strong>d<br />
dabei doch mite<strong>in</strong>ander. Zwar merken wir sofort etwas Auffallendes:<br />
Angenommen, jeder von uns beschäftigte sich jetzt mit<br />
etwas, anderem, mit je e<strong>in</strong>em anderen Gegenstand <strong>in</strong> <strong>die</strong>sem<br />
Saal, dann s<strong>in</strong>d wir zwar zusammen <strong>in</strong> <strong>die</strong>sem Saal, aber doch<br />
nicht eigentlich mite<strong>in</strong>ander; wir existieren gleichsam alle je<br />
von e<strong>in</strong>ander weg - es entstünde e<strong>in</strong> privatives Un-mite<strong>in</strong>ander.<br />
Aber liegt das letztlich an der Verschiedenheit der Objekte, mit<br />
denen wir uns abgeben? Setzen wir den Fall, <strong>die</strong> genannten zwei<br />
Wanderer kommen abends auf ihre Hütte; der e<strong>in</strong>e hackt Holz,<br />
der andere schält Kartoffeln. Hier werden wir ohne Zögern