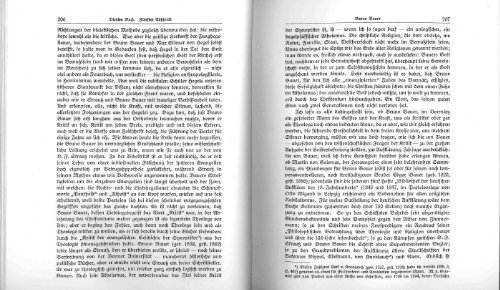Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
206 Viertes Buch. Fünfter Abschnitt<br />
Richtungen der dialektischen Methode zugleich überwunden hat: die orthodoxe<br />
sowohl als die kritische. Was aber die geistige Herkunft der Junghegelianer,<br />
insbesondere der Bruno Bauer und Max Stirner von Hegel selbst<br />
betrifft, so halte man in Gedanken fest, daß Hegel in der Tat den Gott<br />
annihiliert hatte, da er diesen Gott (den persönlichen Gott der Kirche) erst<br />
im Bewußtsein (und wir wissen von keinem anderen Bewußtsein als dem<br />
im Menschen) zu sich selber kommen ließ, da er also eigentlich — nicht<br />
viel anders als Feuerbach, nur versteckter — die Religion anthropologisierte,<br />
in Hominismus wandelte. Nur weil die radikalen Schüler Hegels unseren<br />
höheren Standpunkt der Distanz nicht einnehmen konnten, bemerkten sie<br />
nicht, daß sie Kämpfer in der gleichen Front waren, und befehdeten einander<br />
wie es Strauß und Bruno Bauer mit trauriger Verbissenheit taten.<br />
Und erkannten, alle, nicht die Kraft, mit welcher Stirner, lachend, die<br />
allerletzten Folgerungen aus der Hegelei zog. Dazu kam, daß just Bruno<br />
Bauer sich erst langsam aus der Orthodoxie losmachen mußte, bevor er<br />
Kritik an sich, Kritik um jeden Preis, predigte und mit diesem Extrem,<br />
auch weil er die Waffe einer Zeitschrift besaß, die Führung der Partei für<br />
einige Jahre an sich riß. Wir können heute die Rolle kaum mehr begreifen,<br />
die Bruno Bauer im vormärzlichen Deutschland spielte; seine wissenschaftliche<br />
Leistung erscheint uns zu klein, wenn wir sie auch nur an der von<br />
D. F. Strauß messen. In der Bibelkritik ist er fast rückständig, da er mit<br />
seiner Lehre von einer individuellen Fälschung der späteren Evangelien<br />
doch eigentlich zur Betrugshypothese zurückkehrt, während Strauß in<br />
seinem Mythos etwas wie Volkspoesie angenommen hatte. Bauers Streitigkeiten<br />
um die einzelnen Evangelien sind längst überholt und der Zorn,<br />
mit welchem die Rechts- und die Linkshegelianer einander die Schimpfworte<br />
"Pantheist" und "Atheist" an den Kopf warfen, wirken auf uns fast<br />
erheiternd, weil beide Parteien sich bei diesen scheinbar entgegengesetzten<br />
Begriffen ungefähr das gleiche dachten. Es ist nicht zu verkennen, daß<br />
Bruno Bauer, dessen Lieblingsbegriff das Wort "Kritik" war, in der Ablehnung<br />
des Christentums weiter gegangen ist als irgendein Theologe vor<br />
ihm; aber er beging den Fehler, auch dann noch Theologe sein und als<br />
Theologe wirken zu wollen, als er sich bereits durch seine Bücher (besonders<br />
durch die "Kritik der evangelischen Geschichte der Synoptiker") aus der<br />
Theologie hinausgeschrieben hatte. Bruno Bauer (geb. 1809, gest. 1882)<br />
lebte länger als Strauß, den er überbieten wollte, er schrieb — nach seiner<br />
Vertreibung von der Bonner Universität — mancherlei historische und<br />
politische Bücher, aber er wurde nicht wie Strauß ein freier Schriftsteller.<br />
Er war zu theologisch gewesen, um wieder ganz einfach logisch werden zu<br />
können. Auch sein Atheismus, der unverkennbar das Ziel seiner Kritik<br />
Bruno Bauer 207<br />
der Synoptiker ist, ist — wenn ich so sagen darf — ein unlogischer, ein<br />
hegelpfäffischer Atheismus. Die christliche Religion, die dort einsetze, wo<br />
Natur, Familie, Staat, Weltherrschaft nicht mehr im Bewußtsein seien,<br />
könne ebensogut die Spitze wie das Ende aller Religionen genannt werden;<br />
man könnte es, freilich etwas verhegelt, auch so ausdrücken: Bauers Gott<br />
hat, nachdem er jede Gemeinschaft abgestreift hat, überhaupt keine Gemeinschaft<br />
mehr, in der er zum Selbstbewußtsein kommen, in der er als Gott<br />
angeschaut werden könnte. Sehr merkwürdig ist es dabei, daß Bruno<br />
Bauer, für den sich alle „emanzipierten" Juden des Vormärz erhitzten,<br />
diese Gefolgschaft ablehnte: die Christen stünden schon mit dem einen Fuße<br />
im Atheismus; das auserwählte Volk jedoch müßte, um so weit zu kommen,<br />
erst durch das Christentum hindurchgehen. Ein Wort, das seinen guten<br />
Sinn nach zwei Generationen noch nicht verloren hat.<br />
Ich lasse es also dahingestellt sein, ob Bruno Bauer, im Vormärz<br />
ein gefeierter Mann des Geistes und der Kraft, uns als Kritiker oder gar<br />
als Theologe noch etwas bedeuten könne; da er aber, wie wir gleich erfahren<br />
werden, die führende Persönlichkeit in dem freien Kreise war, aus welchem<br />
Stirner hervorging, müssen wir uns doch fragen, wie sich die um Bauer<br />
— abgesehen von den wissenschaftlichen Fragen der Kritik — zu der großen<br />
Aufgabe der Geistesbefreiung stellten, zur Aufklärung. Ich sage ausdrücklich:<br />
die um Bauer, weil ich keine Gewißheit darüber habe erlangen können,<br />
ob Martin von Geismar, der Herausgeber einer sehr belehrenden Sammlung,<br />
ein Pseudonym für Bruno Bauer selbst sei oder für seinen noch temperamentvolleren,<br />
noch streitlustigeren Bruder Edgar Bauer (geb. 1820,<br />
gest. 1886); jedenfalls sind die seltenen fünf Hefte "Bibliothek der deutschen<br />
Aufklärer des 18. Jahrhunderts" (1846 und 1847, im Parteiverlage von<br />
Otto Wigand in Leipzig erschienen) ein Vademekum für allen religiösen<br />
Radikalismus. Für meine Darstellung der deutschen Aufklärung wäre dem<br />
Buche Geismars (zusammen doch über 750 Seiten) doch manche Ergänzung<br />
zu entnehmen. So zu den Schicksalen Bahrdts sein abgenötigtes<br />
Glaubensbekenntnis und sein Pamphlet gegen den Ritter von Zimmermann;<br />
so zu den Schriften meines Zopfpredigers ein Neudruck seiner<br />
"Philosophischen Betrachtung über Theologie und Religion überhaupt<br />
und über die jüdische insonderheit"; so zu den Kämpfen zwischen D. F.<br />
Strauß und Bruno Bauer die Schrift eines Superintendenten Vogler;<br />
so zu den Grundproblemen der Aufklärung ältere Streitschriften der<br />
Bekenner Dippel, Edelmann, von Knoblauch*) und Riem. Endlich ist<br />
*) Diesen Justizrat Karl v. Knoblauch (geb. 1757, gest. 1794) habe ich bereits (Bd. 3,<br />
S. 467) genannt als einen für Freidenkerei und Revolution begeisterten Mann. M. v. Geis<br />
gibt nun Proben aus einer Reihe von Schriften, von 1789 bis 1794, deren Verfasser