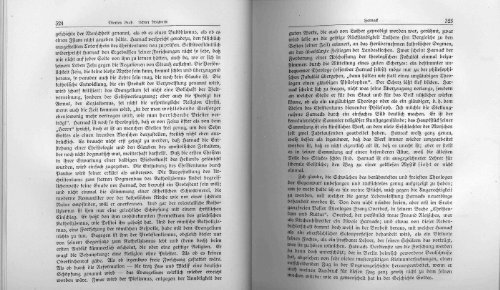Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
324<br />
Viertes Buch. Achter Abschnitt<br />
geschichte der Menschheit genannt, als ob es einen Buddhismus, als ob es<br />
einen Islam nicht gegeben hätte. Harnack verspricht geradezu, den fälschlich<br />
ausgestellten Totenschein des Christentums neu zu prüfen. Selbstverständlich<br />
widerspricht Harnack den Ergebnissen seiner Forschungen nicht so sehr, daß<br />
wir nicht auf jeder Seite von ihm zu lernen hätten, auch da, wo er sich in<br />
seinem Leben Jesu gegen die Negationen von Strauß auflehnt. Die Persönlichkeit<br />
Jesu, die keine bloße Mythe sein kann, kommt schön und überzeugend<br />
heraus, so paradox auch die Lehre sein mag, die noch kein Glaube ist. Die<br />
katholische Entwicklung, die ein Produkt der Verzweiflung genannt wird,<br />
wird scharf kritisiert: das Evangelium sei nicht eine Botschaft der Weltverneinung,<br />
sondern der Selbstverleugnung; aber auch die Predigt der<br />
Armut, der Sozialismus, sei nicht die ursprüngliche Religion Christi,<br />
wenn auch die Zeit kommen wird, "in der man wohllebende Seelsorger<br />
ebensowenig mehr vertragen wird, wie man herrschende Priester verträgt".<br />
Harnack ist noch so theologisch, daß er von Jesus öfter als von dem<br />
"Herrn" spricht, doch er ist an manchen Stellen frei genug, um den Sohn<br />
Gottes als einen irrenden Menschen darzustellen, freilich nicht eben ausdrücklich.<br />
Es braucht nicht erst gesagt zu werden, daß Harnack die Entstehung<br />
einer Christologie und den Glauben des apostolischen Zeitalters,<br />
der noch nicht dogmatisch war, meisterhaft darstellt. Daß die ersten Christen<br />
in ihrer Erwartung einer baldigen Wiederkunft des Heilands getäuscht<br />
wurden, wird einfach zugegeben. Die Entjudung des Christentums durch<br />
Paulus wird feiner erklärt als anderswo. Die Ausgestaltung des Urchristentums<br />
zum starren Dogmenbau des Katholizismus findet begreiflicherweise<br />
keine Gnade vor Harnack, der bewußt ein Protestant sein will;<br />
und nicht einmal die Stimmung einer ästhetischen Schwärmerei, die<br />
moderne Romantiker vor der katholischen Kirche wie vor einer schönen<br />
Ruine empfinden, will er anerkennen. Und gar der orientalische Katholizismus<br />
ist ihm nur eine griechische Schöpfung mit einem christlichen<br />
Einschlag. Er haßt den ihm wohlbekannten Formelkram des griechischen<br />
Katholizismus, wie Tolstoi ihn gehaßt hat. Und der römische Katholizismus,<br />
eine Fortsetzung der römischen Despotie, habe mit dem Evangelium<br />
nichts zu tun. Dagegen ist ihm der Protestantismus, obgleich dieser nur<br />
von seinem Gegensatze zum Katholizismus lebt und (denn doch) beim<br />
ersten Anblick kümmerlich erscheint, die oder eine geistige Religion. Er<br />
wagt die Behauptung: eine Religion ohne Priester. Als ob es keinen<br />
Oberkirchenrat gäbe. Als ob irgendwo freie Forschung gestattet wäre.<br />
Als ob durch die Reformation — die trotz Hus und Wiclif eine deutsche<br />
Schöpfung genannt wird — das Evangelium wirklich wieder erreicht<br />
worden wäre. Zwar wird der Pietismus, entgegen der Unnötigkeit der<br />
Harnack 325<br />
guten Werke, die auch von Luther gepredigt worden war, gerühmt, zwar<br />
wird leise an die geistige Rückständigkeit Luthers (im Vergleiche zu den<br />
Besten seiner Zeit) erinnert, an das Herübernehmen katholischer Dogmen,<br />
an das überstürzte Festlegen der Landeskirchen. Zwar scheint Harnack der<br />
Forderung einer Abschaffung der theologischen Fakultät einmal beizustimmen<br />
durch die Mitteilung eines guten Scherzes: ein bestimmter unbequemer<br />
Theologe (offenbar Harnack selbst) möge nur zu der philosophischen<br />
Fakultät übergehen, "dann hätten wir statt eines ungläubigen Theologen<br />
einen gläubigen Philosophen". Der Scherz läßt tief blicken. Harnack<br />
scheint sich zu fragen, nicht was seine Überzeugung verlange, sondern<br />
an welcher Stelle er für den Staat und für das Volk nützlicher wirken<br />
könne, ob als ein ungläubiger Theologe oder als ein gläubiger, d. h. dem<br />
Wesen des Christentums dienender Philosoph. Ich möchte die Stellungnahme<br />
Harnacks durch ein einfaches Bild deutlich machen. Er ist der<br />
kenntnisreichste Sammler religiöser Kunstgegenstände; das Hauptstück seiner<br />
Sammlung ist ein künstliches Werk, an dem viele Geschlechter der Menschen<br />
seit zwei Jahrtausenden gearbeitet haben. Harnack weiß ganz genau,<br />
weiß besser als irgendwer, daß das Werk immer wieder umgearbeitet<br />
worden ist, daß es nicht eigentlich alt ist, daß es unecht ist; aber er stellt<br />
es in seiner Sammlung auf einen besonderen Altar, weil die ältesten<br />
Teile des Stückes schön sind. Harnack ist ein ausgezeichneter Lehrer für<br />
liberale Geistliche; den Weg zu einer gottlosen Mystik sieht er nicht<br />
einmal.<br />
Ich glaube, die Schwächen des berühmtesten und freiesten Theologen<br />
der Gegenwart unbefangen und rücksichtslos genug aufgezeigt zu haben;<br />
um so mehr halte ich es für meine Pflicht, mich gegen die Ungerechtigkeit<br />
zu wenden, mit welcher die ganze Lebensleistung Harnacks neuerdings<br />
behandelt worden ist. Von dem nicht minder freien, aber erst im Grabe<br />
ganzfreien Basler Theologen Franz Overbeck, in seinem Buche "Christentum<br />
und Kultur". Overbeck, der persönlich treue Freund Nietzsches, war<br />
als Kirchenhistoriker ein Rivale Harnacks; und etwas von dieser Nebenbuhlerschaft<br />
kommt doch wohl in der Bosheit heraus, mit welcher Harnack<br />
als ein oberflächlicher Salonprofessor behandelt wird, als ein Virtuose<br />
seines Faches, als ein strafbarer Lehrer, der seinen Schülern das vorträgt,<br />
was sie zu hören wünschen. Harnacks Verdienste um die Forschung werden<br />
da denn doch unterschätzt; der in Berlin heimisch gewordene Deutschrusse<br />
hat, abgesehen von sehr vielen mustergültigen Kleinuntersuchungen, einen<br />
entscheidenden Zug in der Dogmengeschichte herausgearbeitet, wenn er<br />
auch meinen Ausdruck für diesen Zug ganz gewiß nicht zu dem seinen<br />
machen würde: wie es gemenschelt hat in der Geschichte Gottes.