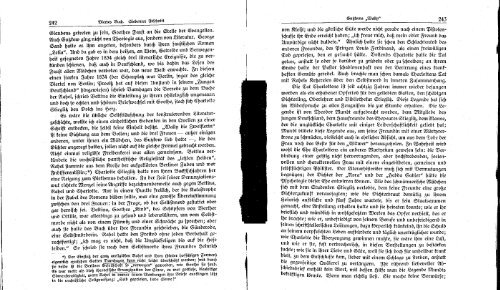Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
242 Viertes Buch. Siebenter Abschnitt<br />
Glaubens getreten zu sein, Goethes Faust an die Stelle der Evangelien.<br />
Auch Gutzkow ging nicht von Theologie aus, sondern von Literatur. George<br />
Sand hatte es ihm angetan, besonders durch ihren faustischen Roman<br />
"Lelia". Und da gab es in dem heißen, an Wein, Getreide und Verwegenheit<br />
gesegneten Jahre 1834 gleich drei literarische Ereignisse, die zu verkünden<br />
schienen, daß auch in Deutschland, wo bis dahin das Lesen des<br />
Faust allen Mädchen verboten war, das neue Weib erwachte. In diesem<br />
einen starken Jahre 1834 (der Schauplatz war Berlin, sogar das gleiche<br />
Viertel von Berlin; Proelß hat auf diesen Umstand in seinem "Jungen<br />
Deutschland" hingewiesen) schrieb Varnhagen die Vorrede zu dem Buche<br />
der Rahel, schrieb Bettina die Einleitung zu ihrem philologisch ungenauen<br />
und doch so echten und schönen Briefwechsel mit Goethe, stach sich Charlotte<br />
Stieglitz den Dolch ins Herz.<br />
Es wäre die übliche Selbsttäuschung der konstruierenden Literaturgeschichte,<br />
wollte ich einen einheitlichen Gedanken in den Quellen zu einer<br />
Schrift entdecken, die selbst keine Einheit besitzt. "Wally die Zweiflerin"<br />
ist keine Dichtung aus dem Vollen; und die drei Frauen — außer einigen<br />
anderen, unter ihnen ein Mädchen, das Gutzkow lieb hatte —, die den<br />
Dichter angeregt hatten, sollen nicht auf die gleiche Formel gebracht werden.<br />
Nicht einmal religiöse Freidenkerei war allen gemeinsam. Bettina verkündete<br />
die unchristliche pantheistische Religiosität des "letzten Heiden",<br />
Rahel stammte aus dem Kreise der aufgeklärten Berliner Juden und war<br />
Indifferentistin;*) Charlotte Stieglitz hatte von ihren Backfischjahren her<br />
eine Neigung zum Pietismus behalten. In der Zeit seiner Denunziationswut<br />
richtete Menzel seine Angriffe bezeichnenderweise auch gegen Bettina,<br />
Rahel und Charlotte. Nur in einem Punkte freilich, der die Katastrophe<br />
in der Fabel des Romans bilden sollte, war eine gewisse Übereinstimmung<br />
zwischen den drei Frauen: in der Frage, ob der Selbstmord gestattet oder<br />
gar heroisch sei. Bettina, Goethes „Kind", des Schöpfers von Werther<br />
und Ottilie, war allerdings zu gesund und lebenslüstern, um vom Selbstmorde<br />
nicht als von einem Fürwitz und einer Schwäche zu sprechen; aber<br />
auch sie hatte das Buch über ihre Freundin geschrieben, die Günderode,<br />
eine Selbstmörderin. Rahel hatte den Freitod ohne jeden Vorbehalt gerechtfertigt;<br />
"ich mag es nicht, daß die Unglückseligen bis auf die Hefe<br />
leiden." So schrieb sie nach dem Selbstmorde ihres Freundes Heinrich<br />
*) Der Einfluß der ganz areligiösen Rahel und ihres (hinter hoffähigen Formen)<br />
eigentlich cynischen Gatten kann nicht leicht überschätzt werden; mit durch<br />
sie beide ist die Berliner Gesellschaft so "verwegen" geworden, wie Goethe sie fand.<br />
Es war mehr als bloß theoretische Emanzipation der Sinne, es war gottlose, diesseitige<br />
Sinnenfreudigkeit, wenn Rahel in immer neuen Wendungen ihre Briefe ausklingen läßt<br />
in die unchristliche Seligpreisung: "Seid gepriesen, liebe Sinne!"<br />
Gutzkows „Wally" 243<br />
von Kleist; und die göttliche Güte werde nicht gerade nach einem Pistolenschusse<br />
ihr Ende erreicht haben; "ich freue mich, daß mein edler Freund das<br />
Unwürdige nicht duldete." Ähnlich hatte sie schon den Schlachtentod des<br />
anderen Freundes, des Prinzen Louis Ferdinand, als einen freiwilligen<br />
Tod gepriesen, den er gesucht hätte. Vollends Charlotte hatte die Tat<br />
getan, anstatt so oder so darüber zu grübeln oder zu schreiben; an ihrem<br />
Grabe hatte der Pastor schablonenhaft von der Verirrung eines krankhaften<br />
Gemüts geredet. Auch brachte man schon damals Charlottens Tat<br />
mit Rahels Ketzereien über den Selbstmord in inneren Zusammenhang.<br />
Die Tat Charlottens ist seit achtzig Jahren immer wieder besungen<br />
worden als ein erhabener Opfertod für den geliebten Gatten, den schäbigen<br />
Dichterling, Oberlehrer und Bibliothekar Stieglitz. Diese Legende hat sich<br />
im Widerspruche zu allen Zeugnissen bis zur Stunde erhalten. Die Legende<br />
ist von Theodor Mundt aufgebracht worden, dem Mitgliede des<br />
jungen Deutschland, dem Hausfreunde des Ehepaares Stieglitz, dem Manne,<br />
der die unglückliche Charlotte mit einiger Leidenschaftlichkeit geliebt hat;<br />
Mundt bildete diese Legende aus, um seine Freundin mit einer Märtyrerkrone<br />
zu schmücken, vielleicht auch in ehrlicher Absicht, um aus dem Tode der<br />
Frau noch das Beste für den "Witwer" herauszuholen. In Wahrheit wird<br />
wohl die Ehe Charlottens ein anderes Martyrium gewesen sein: die Verbindung<br />
einer geistig nicht hervorragenden, aber hochstrebenden, seelenvollen<br />
und charaktervollen Frau mit einem eingebildeten, gemeinen und<br />
selbstsüchtigen Philister. Der Literarhistoriker muß sich mit Vermutungen<br />
begnügen; der Dichter der "Nora" und der „Hedda Gabler" hätte die<br />
Psychologie dieser Ehe entwirren können. Wie das schwärmerische Mädchen<br />
sich mit dem Studenten Stieglitz verlobte, dem seine Freunde eine große<br />
Dichterzukunft voraussagten; wie die Dichterbraut demütig zu ihrem<br />
Heinrich aufblickte und fünf Jahre wartete, bis er sein Staatsexamen<br />
gemacht, eine Anstellung erhalten hatte und sie heiraten konnte; wie er ihr<br />
brieflich und mündlich in wohlgesetzten Worten das Opfer vorhielt, das er<br />
ihr brächte; wie er, unbefriedigt von seinem Berufe und unbefriedigend in<br />
seinen schriftstellerischen Leistungen, dazu körperlich kränkelnd, ihr die Schuld<br />
an seinem verpfuschten Leben aufbürdete und täglich unerträglicher wurde;<br />
wie Charlotte die Überzeugung gewinnen mußte, sie wäre ihm eine Last,<br />
und wie er sie, fast verbrecherisch, in diesen Vorstellungen zu bestärken<br />
suchte; wie sie in ihrer Liebe und Güte, weil sie sich doch für unheilbar krank<br />
hielt, zu dem Entschlusse kam, lieber mit einem Schlage zu sterben, anstatt<br />
die gegenseitige Quälerei zu verlängern. Ihr rührend liebevoller Abschiedsbrief<br />
enthält kein Wort, mit dessen Hilfe man die Legende Mundts<br />
bekräftigen könnte. Wenn man richtig liest. Sie mache keine Vorwürfe;