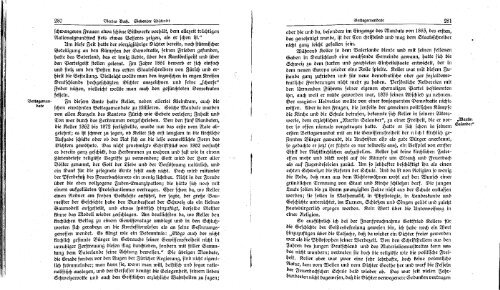Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
280 Viertes Buch. Siebenter Abschnitt<br />
schwangeren Frauen etwa schöne Bildwerke vorhält, dem allezeit trächtigen<br />
Nationalgrundstock stets etwas Besseres zeigen, als er schon ist."<br />
Um diese Zeit hatte der vierzigjährige Dichter bereits, nach stürmischer<br />
Beteiligung an den Kämpfen der Demokratie, seinen Frieden gefunden,<br />
hatte das Vaterland, das er innig liebte, über den Kantönligeist und über<br />
den Parteigeist stellen gelernt. Im Jahre 1861 bewarb er sich einfach<br />
und stolz um den Posten des ersten Staatsschreibers von Zürich und erhielt<br />
die Bestallung. Vielleicht wollte man den inzwischen in engen Kreisen<br />
Deutschlands hochgeschätzten Dichter auszeichnen und seine "scharfe"<br />
Feder nützen, vielleicht wollte man auch den gefürchteten Demokraten<br />
fesseln.<br />
In diesem Amte hatte Keller, neben allerlei Kleinkram, auch die<br />
schon erwähnten Bettagsmandate zu stilisieren. Solche Mandate wurden<br />
von allen Kanzeln des Kantons Zürich wie Gebete verlesen; Inhalt und<br />
Ton war durch das Herkommen vorgeschrieben. Von den fünf Mandaten,<br />
die Keller 1862 bis 1872 fertigstellte, wurde nur das erste vom Rate abgelehnt;<br />
es ist schwer zu sagen, ob Keller sich erst langsam in die kirchliche<br />
Aufgabe schickte oder ob der Rat sich an die leise verweltlichte Form des<br />
Dichters gewöhnte. Das nicht genehmigte Schriftstück von 1862 versucht<br />
es bereits ganz geschickt, das Herkommen zu wahren und fast wie in einem<br />
Hirtenbriefe religiöse Begriffe zu verwenden; Gott wird der Herr aller<br />
Völker genannt, der Gott der Liebe und der Versöhnung natürlich, und<br />
ein Dank für die gesegnete Ernte fehlt auch nicht. Doch wird mitunter<br />
der Pferdefuß des Feuerbachianers ein wenig sichtbar. Nicht in der Freude<br />
über die eben vollzogene Juden-Emanzipation; die hätte sich noch mit<br />
einem aufgeklärten Protestantismus vertragen. Eher schon da, wo Keller<br />
einen Redner am frohen Volksfeste anführt, der sagte, der große Baumeister<br />
der Geschichte habe den Bundesstaat der Schweiz als ein kleines<br />
Baumodell aufgestellt, und etwas spöttisch hinzufügt, derselbe Meister<br />
könne das Modell wieder zerschlagen. Am deutlichsten da, wo Keller den<br />
kirchlichen Bettag zu einem Gewissenstage umbiegt und in den Schlußworten<br />
sich geradezu an die Konfessionslosen als an seine Gesinnungsgenossen<br />
wendet. Es klingt wie ein Bekenntnis: "Möge auch der nicht<br />
kirchlich gesinnte Bürger im Gebrauche seiner Gewissensfreiheit nicht in<br />
unruhiger Zerstreuung diesen Tag durchleben, sondern mit stiller Sammlung<br />
dem Vaterlande seine Achtung beweisen." Die übrigen Mandate,<br />
die Gnade fanden vor den Augen der Züricher Regierung, sind nicht eigentlich<br />
frömmelnder; man kann sie, wenn man will, deistisch und sogar rationalistisch<br />
auslegen, und der Verfasser benützt die Gelegenheit, seinem lieben<br />
Schweizervolke und auch den Geistlichen erziehliche Wahrheiten zu sagen;<br />
Bettagsmandate 281<br />
aber hie und da, besonders im Eingange des Mandats von 1863, des ersten,<br />
das genehmigt wurde, ist der Ton christelnd und mag dem Staatsschreiber<br />
nicht ganz leicht gefallen sein.<br />
Während Keller so dem Vaterlande diente und mit seinen seltenen<br />
Gaben in Deutschland eine wachsende Gemeinde gewann, hatte sich die<br />
Schweiz zu dem starken und geachteten Einheitsstaat entwickelt, der in<br />
dem neuen Europa wieder eine Rolle spielte. Keller war mit diesem Zustande<br />
ganz zufrieden und für neue demokratische oder gar sozialdemokratische<br />
Forderungen nicht mehr zu haben. Persönliche Reibereien mit<br />
den lärmenden Führern seiner eigenen ehemaligen Partei bestimmten<br />
ihn, auch weil er müde geworden war, 1876 seinen Abschied zu nehmen.<br />
Der magister Helvetiae wollte von einer konsequenten Demokratie nichts<br />
wissen. Aber in den Fragen, die jenseits der gemeinen politischen Kämpfe<br />
die Kirche und die Schule betrafen, bekannte sich Keller in seinem Alterswerke,<br />
dem erziehlichen "Martin Salander", zu einer Freiheit, die er vorher<br />
so offen niemals vorgetragen hatte. Hatte er sich schon in seinem<br />
ersten Bettagsmandat mit an die Gewissensfreiheit der nicht kirchlich gesinnten<br />
Bürger gewandt, die Unchristen also als gute Bürger anerkannt,<br />
so gedachte er jetzt (er führte es nur teilweise aus), ein Beispiel von ernster<br />
Ethik der Nichtkirchlichen aufzustellen. Keller hat keine kirchlichen Interessen<br />
mehr und blickt wohl auf die Kämpfe um Strauß und Feuerbach<br />
als auf Jugendeseleien zurück. Um so lebhafter beschäftigt ihn als einen<br />
echten Schweizer die Reform der Schule. Und da ist von Religion so wenig<br />
die Rede, daß man aus dem Nichterwähnen wohl auf den Wunsch einer<br />
gründlichen Trennung von Staat und Kirche schließen darf. Die jungen<br />
Leute sollen bis zu ihrem zwanzigsten Jahre nicht aus der Schule entlassen<br />
werden; sie sollen in Mathematik, in Physiologie, in Landeskunde und<br />
Geschichte unterrichtet, im Turnen, Schießen und Singen geübt und zuletzt<br />
staatsbürgerlich erzogen werden. Kein Wort über die Unterweisung in<br />
einer Religion.<br />
So ausführlich ich bei der Inanspruchnahme Gottfried Kellers für<br />
die Geschichte der Geistesbefreiung gewesen bin, ich habe noch ein Wort<br />
hinzuzufügen über die Tatsache, daß da wieder ein Dichter freier geworden<br />
war als die Philosophen seiner Werdezeit. Von den Schriftstellern aus den<br />
Jahren des jungen Deutschland und des Materialismusstreites kann uns<br />
das nicht wundern; vertraten sie doch die religiöse wie die politische Freiheit.<br />
Keller aber war zwar eine sehr lehrhafte, doch keine polemische<br />
Natur, kam vom Weisen und vom Dichter Goethe her und warf die Fesseln<br />
der Feuerbachschen Schule bald wieder ab. Das war seit vielen Jahrhunderten<br />
nicht dagewesen, daß die Dichter verwegenere Gedanken vortrugen