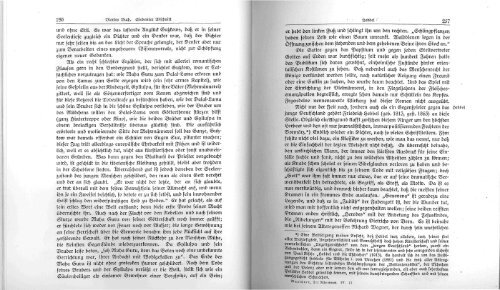Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
256 Viertes Buch. Siebenter Abschnitt<br />
und ohne Stil. Es war das lastende Unglück Gutzkows, daß er in seiner<br />
Seelentiefe zugleich ein Dichter und ein Denker war, daß der Dichter<br />
nur sehr selten bis an das Licht der Sprache gelangte, der Denker aber nur<br />
zum Verarbeiten eines ungeheuern Wissensvorrats, nicht zur Schöpfung<br />
eigener neuer Gedanken.<br />
Als ein recht schlechter Erzähler, der sich mit allerlei romantischen<br />
Flausen gern in den Vordergrund stellt, berichtet Gutzkow, was er Tatsächliches<br />
vorzutragen hat: wie Maha Guru zum Dalai-Lama erkoren und<br />
von den Lamas zum Gotte erzogen wird (ein sehr armes Kapitel), wie<br />
seine Gespielin aus der Kinderzeit, Gylluspa, für ihre Väter (Mehrmännerei)<br />
zittert, weil sie als Götzenverfertiger vom Kanon abgewichen sind und<br />
für diese Ketzerei die Todesstrafe zu befürchten haben, wie der Dalai-Lama<br />
und sein Bruder sich in die schöne Gylluspa verlieben, wie der Bruder um<br />
des Mädchens willen den Dalai-Lama vom Götterthrone stürzen hilft<br />
(ganz Hintertreppe oder Kino), wie die beiden Brüder und Gylluspa in<br />
einem dreieckigen Verhältnisse überaus glücklich sind. Die ausführlich<br />
erörterte und motivierende Sitte der Mehrmännerei soll das Ganze, Gutzkow<br />
war damals offenbar ein Schüler von Eugen Sue, pikanter machen;<br />
dieser Zug tritt allerdings europäische Ehrbarkeit mit Füßen und ist widerlich,<br />
weil er es absichtlich tut, nicht aus künstlerischen oder sonst unabweisbaren<br />
Gründen. Was dann gegen den Blutdurst der Priester vorgebracht<br />
wird, ist geschickt in die tibetanische Kleidung gehüllt, bleibt aber trotzdem<br />
in der Schablone stecken. Überraschend gut ist jedoch daneben der Seelenzustand<br />
des jungen Menschen geschildert, den man als einen Gott verehrt<br />
und der an sich glaubt. "Er war nicht der letzte, der an sich glaubte,<br />
er trat überall mit dem festen Bewußtsein seiner Allmacht auf, und wenn<br />
ihn je ein Zweifel beschlich, so betete er zu sich selbst, und sein inwohnender<br />
Geist schlug den widerspänstigen Leib zu Boden." Er hat gelacht, als auf<br />
sein erstes Wort eine Welt entstand; denn diese erste Probe seiner Macht<br />
überraschte ihn. Auch nach der Flucht vor den Rebellen und nach seinem<br />
Sturze wurde Maha Guru von seiner Götterschaft noch immer geäfft;<br />
er fürchtete sich weder vor Feuer noch vor Wasser; die lange Gewöhnung<br />
an seine Herrschaft über die Elemente benahm ihm jede Rücksicht auf ihre<br />
zerstörende Gewalt. Er hat nach seiner Rückkehr zu den Menschen Mühe,<br />
die kleinsten Gegenstände wiederzuerkennen. Da Gylluspa und sein<br />
Bruder leise beten, „sah Maha Guru, dem das Beten noch eine unbekannte<br />
Verrichtung war, ihrer Andacht mit Wohlgefallen zu". Das Ende des<br />
Maha Guru ist nicht ohne grotesken Humor geschildert. Nach dem Tode<br />
seines Bruders und der Gylluspa verläßt er die Welt, stellt sich wie ein<br />
Säulenheiliger als einsamer Bewohner einer Bergspitze, auf ein Bein;<br />
Hebbel 257<br />
er hebt den linken Fuß und schlingt ihn um den rechten. "Schlingpflanzen<br />
haben seinen Leib wie einen Baum umrankt. Waldbienen legen in der<br />
Öffnung zwischen dem stehenden und dem gehobenen Beine ihren Stock an."<br />
Die Satire gegen das Papsttum und gegen jeden Stellvertreter<br />
Gottes auf Erden war durchsichtig; seit mehr als hundert Jahren hatte<br />
das Publikum sich daran gewöhnt, einheimische Zustände hinter orientalischen<br />
Kostümen zu sehen. Daß nebenbei auch das Menschenrecht der<br />
Könige verkündet werden sollte, nach natürlicher Neigung einen Freund<br />
oder eine Gattin zu suchen, das wurde kaum beachtet. Und das Spiel mit<br />
der Einrichtung der Vielmännerei, in den Flegeljahren der Fleischesemanzipation<br />
begreiflich, erregte schon damals nur Schütteln des Kopfes.<br />
Irgendeine nennenswerte Wirkung hat dieser Roman nicht ausgeübt.<br />
Nicht nur der Zeit nach, sondern auch als ein Gegenspieler gegen das Hebbel<br />
junge Deutschland gehört Friedrich Hebbel (geb. 1813, gest. 1863) an diese<br />
Stelle. Obgleich ein Abgrund klafft zwischen diesem Ringer um den höchsten<br />
Lorbeer und den oft nur journalistischen, immer politisierenden Fechtern des<br />
Vormärz.*) Endlich wieder ein Dichter, nach so vielen Schriftstellern. Ihm<br />
fehlte nicht viel dazu, ein Klassiker zu werden, wie man das nennt, nur daß<br />
er die Einfachheit der letzten Weisheit nicht besaß. Es überrascht beinahe,<br />
den unkirchlichen Mann, der immer den stärksten Ausdruck für seine Einfälle<br />
suchte und fand, nicht zu den wildesten Atheisten zählen zu können;<br />
als Knabe schon scheint er seinen Bibelglauben verloren zu haben und beschäftigte<br />
sich eigentlich bis zu seinem Tode mit religiösen Fragen; doch<br />
"Gott" war ihm fast immer nur etwas, das er auf seine dramatische Verwendbarkeit<br />
hin betrachtete, als Begriff, als Stoff, als Motiv. Da ist es<br />
nun merkwürdig, und dennoch bisher kaum beachtet, daß die meisten seiner<br />
Dramen in ein frommes Ende auslaufen. "Genoveva" ist geradezu eine<br />
Legende, und daß es in "Judith" der Judengott ist, der die Wunder tut,<br />
wird man mir hoffentlich nicht entgegenhalten wollen; seine beiden reifsten<br />
Dramen enden christlich, "Herodes" mit der Anbetung des Jesuskindes,<br />
die "Nibelungen" mit der Bekehrung Dietrichs von Bern. Es ist beinahe<br />
wie bei seinem Altersgenossen Richard Wagner, der durch sein unehrliches<br />
*) Eine Bestätigung meiner Ansicht, daß Hebbel trotz alledem, trotz seiner (bei<br />
aller Maßlosigkeit, Ungeheuerlichkeit und Bewußtheit) doch hohen Künstlerschaft und seiner<br />
vermeintlichen "Unzeitgemäßheit" von dem "jungen Deutschland" herkam, zuerst ein<br />
Nebenbuhler, dann ein Gegner, finde ich in der lesenswerten und sehr anregenden Schrift<br />
von Paul Kisch: "Hebbel und die Tschechen" (1913). Es handelt sich da um das Huldigungsgedicht<br />
Hebbels für Wilhelm I. von Preußen (1861) und die trotz aller Ableugnungen<br />
des Dichters bitterbösen Beschimpfungen der "Bedientenvölker", der Tschechen<br />
und der Polen; aber wir lernen den oft nur kannegießernden, oft aber auch seherhaften<br />
Politiker Hebbel gründlich kennen, mit seinem durchdringen Scharfsinn und mit seinen<br />
menschlichen Schwächen.