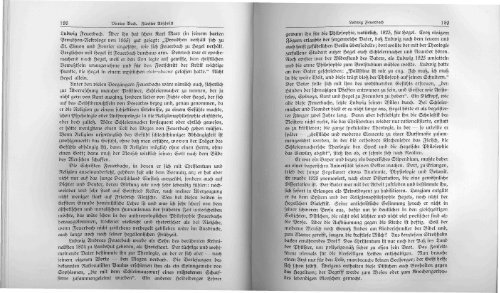Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
1 88 Viertes Buch. Fünfter Abschnitt<br />
Ludwig Feuerbach. Über ihn hat schon Karl Marx (in seinem harten<br />
Proudhon-Nekrologe von 1865) gut gesagt: „Proudhon verhält sich zu<br />
St. Simon und Fourier ungefähr, wie sich Feuerbach zu Hegel verhält.<br />
Verglichen mit Hegel ist Feuerbach durchaus arm. Dennoch war er epochemachend<br />
nach Hegel, weil er den Ton legte auf gewisse, dem christlichen<br />
Bewußtsein unangenehme und für den Fortschritt der Kritik wichtige<br />
Punkte, die Hegel in einem mystischen clair-obscur gelassen hatte." Nicht<br />
Hegel allein.<br />
Unter den vielen Vorgängern Feuerbachs wäre nämlich auch, sicherlich<br />
zur Überraschung mancher positiver, Schleiermacher zu nennen, der ja<br />
nicht gern von Kant ausging, sondern lieber von Fichte oder Hegel, der sich<br />
auf das Selbstbewußtsein von Descartes bezog und, genau genommen, da<br />
er die Religion zu einem subjektiven Erlebnisse, zu einem Gefühle machte,<br />
schon Psychologie oder Anthropologie in die Religionsphilosophie einführte,<br />
oder doch zuließ. Wäre Schleiermacher konsequent oder ehrlich gewesen,<br />
er hätte wenigstens einen Teil des Weges von Feuerbach gehen müssen.<br />
Wenn Religion ursprünglich das Gefühl schlechthinniger Abhängigkeit ist<br />
(wohlgemerkt: das Gefühl, ohne daß man erführe, wovon der Träger des<br />
Gefühls abhängig ist), dann ist Religion möglich ohne einen Herrn, ohne<br />
einen Gott; dann muß der Mensch wirklich seinen Gott nach dem Bilde<br />
des Menschen schaffen.<br />
Die Schriften Feuerbachs, in denen er sich mit Christentum und<br />
Religion auseinandersetzt, gehören fast alle dem Vormärz an; er hat aber<br />
nicht nur auf das junge Deutschland Einfluß ausgeübt, sondern auch auf<br />
Dichter und Denker, deren Wirkung wir noch sehr lebendig fühlen: nachweisbar<br />
und sehr stark auf Gottfried Keller, nach meiner Überzeugung<br />
nicht weniger stark auf Friedrich Nietzsche. Was bei diesen beiden in<br />
tiefstem Grunde hoministische Lehre ist und was ich sehr scharf von dem<br />
ästhetischen und moralischen Humanismus der früheren Zeit unterscheiden<br />
möchte, das wäre schon in der anthropologischen Philosophie Feuerbachs<br />
herausgekommen, trockener vielleicht und rhetorischer als bei Nietzsche,<br />
wenn Feuerbach nicht zeitlebens verhegelt geblieben wäre im Ausdrucke,<br />
auch lange noch nach seiner hegelianischen Frühzeit.<br />
Ludwig Andreas Feuerbach wurde als Sohn des berühmten Kriminalisten<br />
1804 zu Landshut geboren, als Protestant. Der tüchtige und wohlmeinende<br />
Vater bestimmte ihn zur Theologie, an der er sich aber — nach<br />
seinem eigenen Worte — den Magen verdarb. Die Vorlesungen des<br />
bekannten Rationalisten Paulus erschienen ihm als ein Spinngewebe von<br />
Sophismen, „die mit dem Schleimauswurf eines mißratenen Scharfsinns<br />
zusammengeleimt wurden". Ein anderer Heidelberger Lehrer<br />
Ludwig Feuerbach 189<br />
gewann ihn für die Philosophie, natürlich, 1823, für Hegel. Trotz einigem<br />
Zögern erlaubte der sorgenreiche Vater, daß Ludwig nach dem teuern und<br />
auch sonst gefährlichen Berlin übersiedelte; dort wollte der mit der Theologie<br />
zerfallene Student außer Hegel auch Schleiermacher und Neander hören.<br />
Noch ernster war der Widerstand des Vaters, als Ludwig 1825 umsatteln<br />
und die arme Philosophie zum Brotstudium wählen wollte. Ludwig hatte<br />
an den Vater geschrieben: "Palästina ist mir zu eng. Ich muß, ich muß<br />
in die weite Welt, und diese trägt bloß der Philosoph auf seinen Schultern."<br />
Der Vater solle sich mit ihm des wohltuenden Gefühls erfreuen, „den<br />
Händen der schmutzigen Pfaffen entronnen zu sein, und Geister wie Aristoteles,<br />
Spinoza, Kant und Hegel zu Freunden zu haben". Ein Dickkopf, wie<br />
alle diese Feuerbachs, setzte Ludwig seinen Willen durch. Bei Schleiermacher<br />
und Neander hielt er es nicht lange aus, Hegel hörte er als begeisterter<br />
Jünger zwei Jahre lang. Dann aber befriedigte ihn die Scholastik des<br />
Meisters nicht mehr, die das Christentum wieder nur rationalisierte, anstatt<br />
es zu kritisieren; die ganze spekulative Theologie, in der — so urteilte er<br />
später — "christliche und moderne Elemente zu einer Wurstmasse zusammengerührt<br />
werden, in der die orthodoxe Kirchenlehre das Fleisch, die<br />
Schleiermachersche Theologie den Speck und die Hegelsche Philosophie<br />
das Gewürz abgibt", stieß ihn ab, er sehnte sich nach Realien.<br />
Er war ein Bayer und bezog ein bayerisches Stipendium, mußte daher<br />
an einer bayerischen Universität seinen Doktor machen. Dort, zu Erlangen,<br />
trieb der junge Hegelianer etwas Anatomie, Physiologie und Botanik.<br />
Er wurde 1828 promoviert, nach einer Dissertation, die eine gewöhnliche<br />
Dissertation ist. Der Vater war mit der Arbeit zufrieden und bestimmte ihn,<br />
sich sofort in Erlangen als Privatdozent zu habilitieren. Langsam entglitt<br />
er da dem System und der Religionsphilosophie Hegels, noch nicht der<br />
Hegelschen Dialektik. Seine antichristliche Gesinnung sprach er nicht in<br />
seiner schweren Prosa aus, dafür um so deutlicher in den gleichzeitigen<br />
Gedichten, Distichen, die nicht viel leichter und nicht viel poetischer sind als<br />
die Prosa. Aber die Aufbäumung gegen die Kirche ist heftig. Soll der<br />
moderne Mensch noch Genuß finden am Kinderschnuller der Bibel und,<br />
zum Manne gereift, saugen die kraftlose Milch? Aus kernlosem Strohhalm<br />
backen ernährendes Brot? Das Christentum ist nur noch der Paß ins Land<br />
der Philister, um polizeigemäß sicher zu essen sein Brot. Das Jenseits<br />
könne niemals für die diesseitigen Leiden entschädigen. Man brauche<br />
einen Arzt nur für den Leib, man brauche keinen Seelsorger; der Geist helfe<br />
sich schon selbst. Übrigens enthalten diese Distichen auch Bosheiten gegen<br />
das Hegeltum; der Begriff werde zum Wesen oder zum Knochengerippe<br />
des lebendigen Menschen gemacht.