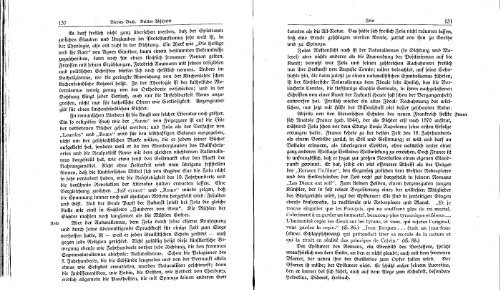Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
130<br />
Viertes Buch. Dritter Abschnitt<br />
Es darf freilich nicht ganz übersehen werden, daß der Spielraum<br />
zwischen Glauben und Unglauben im Protestantismus sehr weit ist, in<br />
der Theologie, also erst recht in der Dichtung. Ein Werk wie "Die Heilige<br />
und ihr Narr" von Agnes Günther, kaum einem bestimmten Bekenntnisse<br />
zuzuschreiben, kann noch für einen kirchlich frommen Roman gelten.<br />
Frenssen mit seinen Erzählungen, Friedrich Naumann mit seinen religiösen<br />
und politischen Schriften dürfen sich noch christlich nennen. Anders im<br />
Katholizismus, wo die geringste Abweichung von der Kirchenlehre schon<br />
kirchenfeindliche Ketzerei heißt. In der Theologie ist der katholische Modernismus<br />
wenig genug von der Orthodoxie verschieden; und in der<br />
Dichtung klingt jeder Versuch, auch nur die Unfehlbarkeit Roms anzugreifen,<br />
nicht nur für katholische Ohren wie Gottlosigkeit. Anzengruber<br />
gilt für einen kirchenfeindlichen Dichter.<br />
In romanischen Ländern ist die Angst vor solcher Literatur noch größer.<br />
Ein so religiöses Buch wie der „Santo" von Fogazzaro ist auf die Liste<br />
der verbotenen Bücher gesetzt worden; und Zola als der Verfasser von<br />
„Lourdes" und „Rome" wird für den leibhaftigen Satanas ausgegeben,<br />
nicht um der geschlechtlichen Marke willen, die er jedem seiner Bücher<br />
aufgeklebt hat, sondern weil er da den Wunderglauben des Wallfahrtsortes<br />
und die Realpolitik Roms mit dem gleichen nüchternen Rationalismus<br />
dargestellt hat, wie etwa sonst den Geldmarkt oder den Markt der<br />
Nahrungsmittel. Nicht ohne Heiterkeit wird man übrigens feststellen<br />
können, daß die künstlerischen Mittel sich von Eugène Sue bis Zola nicht<br />
so sehr verändert haben, wie die Raschlebigkeit des 19. Jahrhunderts und<br />
die berühmte Revolution der Literatur hätten erwarten lassen. Eine<br />
Vergleichung zwischen „Juif errant" und „Rome" würde zeigen, daß<br />
die Spannung immer noch mit ähnlichen Mitteln hergestellt wird: Jesuiten<br />
und Gift. Und der ideale Papst der Zukunft spielt bei Zola die gleiche<br />
Rolle wie einst in Gutzkows "Zauberer von Rom". Die Mühlen der<br />
Dichter mahlen noch langsamer als die Mühlen Gottes.<br />
Zola Aber der Naturalismus, dem Zola durch seine eiserne Konsequenz<br />
und durch seine überwältigende Sprachkraft für einige Zeit zum Siege<br />
verholfen hatte, ist — weil er jeden idealistischen Schein zerstört — auch<br />
gegen jede Religion gerichtet. Nicht zufällig heißt diese künstlerische Bewegung<br />
ebenso wie Jahrhunderte vorher jede Richtung, die den frommen<br />
Supranaturalismus ablehnte: Naturalismus. Schon die Pelagianer des<br />
5. Jahrhunderts, die die Erbsünde leugneten und von der Vernunft allein<br />
etwas wie Seligkeit erwarteten, wurden Naturalisten geschimpft; dann<br />
die Indifferentisten, wie Bodin, die Deisten, wie Herbert von Cherbury,<br />
endlich allgemein die Pantheisten, die mit Spinoza keinen anderen Gott<br />
Zola 131<br />
kannten als die All-Natur. Das hätte sich freilich Zola nicht träumen lassen,<br />
daß eine Brücke geschlagen werden könnte, zurück von ihm zu Goethe<br />
und zu Spinoza.<br />
Zolas Weltansicht nach ist der Naturalismus (in Dichtung und Malerei)<br />
aber nichts anderes als die Anwendung des Positivismus auf die<br />
Kunst; bewußt war Zola und seinen zahlreichen Nachahmern freilich<br />
nur ihre Herkunft von Auguste Comte; näher betrachtet, auf seine Sehnsüchte<br />
hin, die dann zuletzt zu einem naturalistischen Symbolismus führten,<br />
ist der künstlerische Naturalismus dem Ideale sehr ähnlich, das die Vorläuferin<br />
Comtes, die tiefsinnige Sophie Germain, in ihren nachgelassenen<br />
Schriften von einer Kunst der Zukunft (heute fast schon der Vergangenheit)<br />
entworfen hat. Freilich wieder ein altes Ideal: Nachahmung der wirklichen,<br />
nur jetzt mit Hilfe der Wissenschaft viel besser geschauten Natur.<br />
Abseits von den literarischen Schulen des neuen Frankreich stellte France<br />
sich Anatole France (geb. 1844), der als Dichter erst nach 1870 auftrat,<br />
während Zola schon vor dem Sturze Louis Napoleons seine ersten Erfolge<br />
errungen hatte. France kehrte zu der besten Zeit des 18. Jahrhunderts<br />
als einem Vorbilde zurück, in Stil und Gesinnung; er will und darf an<br />
Voltaire erinnern, als überlegener Spötter, ohne natürlich unter einer<br />
ganz anderen Weltlage Voltaires Weltwirkung zu erreichen. Doch France ist<br />
so unfranzösisch, daß er sogar zur großen Revolution einen eigenen Standpunkt<br />
gewinnt. Er hat, selbst ein viel offenerer Atheist als der Präger<br />
des „Ecrasez l'infâme", den Gegensatz zwischen dem Deisten Robespierre<br />
und den Gottesfeinden der Zeit recht gut dargestellt in seinem Romane<br />
„Les Dieux ont soif". Zum kleinen Helden, einem herzensguten jungen<br />
Künstler, der in fast reiner Begeisterung eines der wildesten Mitglieder<br />
des Blutgerichts wird, sagt der Epikureer: Sie sind in jenseitigen Dingen<br />
ebenso konservativ, ja reaktionär wie Robespierre und Marat. „Et je<br />
trouve singulier que les Français, qui ne souffrent plus de roi mortel,<br />
s'obstinent à en garder un immortel, beaucoup plus tyrannique et féroce...<br />
L'humanité copie ses dieux sur les tyrans, et vous, qui rejetez l'original,<br />
vous gardez la copie." (S. 86.) „Jean Jacques ... était un jean-fesse<br />
(etwa: Schlappschwanz) qui prétendait tirer sa morale de la nature et<br />
qui la tirait en réalité des principes de Calvin." (S. 88.)<br />
Der Epikureer des Romans, ein Ebenbild des Verfassers, spricht<br />
unaufhörlich von dem Gotte, an den er nicht glaubt; auch mit dem frommen<br />
Pfarrer, der neben ihm der Guillotine zum Opfer fallen wird. Der<br />
Pfarrer ist milde; der Epikureer nicht. Er schätzt außer seinem Lucretius,<br />
den er immer bei sich führt, auch auf dem Wege zum Schafott, besonders<br />
Helvetius, Diderot, Holbach.