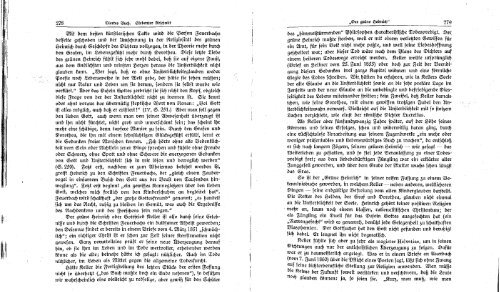Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
278 Viertes Buch. Siebenter Abschnitt<br />
Mit dem besten künstlerischen Takte wird die Person Feuerbachs<br />
beiseite geschoben und der Umschwung in der Religiosität des grünen<br />
Heinrich durch Geschöpfe des Dichters vollzogen, in der Theorie mehr durch<br />
den Grafen, im Lebensgefühl mehr durch Dorothea. Diese letzte Liebe<br />
des grünen Heinrich fühlt sich sehr wohl dabei, daß sie auf eigene Faust,<br />
aus dem kindlichsten und reinsten Herzen heraus die Unsterblichkeit nicht<br />
glauben kann. „Wer sagt, daß es ohne Unsterblichkeitsglauben weder<br />
Poesie noch Lebensweihe in der Welt gebe, der hätte sie sehen müssen;<br />
nicht nur Natur und Leben um sie herum, sondern sie selbst wurde wie<br />
verklärt." Über das Dasein Gottes zerbricht sie sich nicht den Kopf, obgleich<br />
diese Frage von der der Unsterblichkeit nicht zu trennen ist. Sie kennt<br />
oder ahnt voraus das übermütig skeptische Wort von Renan: "Bei Gott<br />
ist alles möglich, auch daß er existiert!" (IV, S. 251.) Aber man soll gegen<br />
den lieben Gott, auch wenn man von seiner Abwesenheit überzeugt ist<br />
und ihn nicht fürchtet, nicht grob und unverschämt sein; das scheint ihr<br />
mehr eine schäbige, denn tapfere Manier zu sein. Durch den Grafen und<br />
Dorothea, die ihn mit einem sehnsüchtigen Glücksgefühl erfüllt, lernt er<br />
die Gedanken freier Menschen kennen. "Ich hörte ohne alle Bedenklichkeit<br />
vom Sein oder Nichtsein jener Dinge sprechen und fühlte ohne Freude<br />
oder Schmerz, ohne Spott und ohne Schwere die anerzogenen Gedanken<br />
von Gott und Unsterblichkeit sich in mir lösen und beweglich werden"<br />
(S. 259). Jetzt erst, nachdem er zum Atheismus bekehrt worden ist,<br />
greift Heinrich zu den Schriften Feuerbachs, der "gleich einem Zaubervogel<br />
in einsamem Busch den Gott aus der Brust von Tausenden hinwegsang".<br />
Jetzt erst beginnt "ein gewisses Kannegießern über den lieben<br />
Gott, welches mich freilich von den Kinderschuhen an begleitet hat".<br />
Feuerbach wird schalkhaft "der große Gottesfreund" genannt; "es handelt<br />
sich um das Recht, ruhig zu bleiben im Gemüt, was auch die Ergebnisse<br />
des Nachdenkens und des Forschens sein mögen."<br />
Der grüne Heinrich oder Gottfried Keller ist also durch seine Erlebnisse<br />
und durch die Schriften Feuerbachs ein duldsamer Atheist geworden;<br />
den Deismus findet er bereits in einem Briefe vom 4. März 1851 "schwächlich";<br />
ein richtiger Christ ist er schon zur Zeit seiner Konfirmation nicht<br />
gewesen. Ganz vorurteilslos prüft er seine neue Überzeugung darauf<br />
hin, ob sie ihm im Leben und im Tode wertvoller, erhebender werden<br />
könne als die alte; beinahe hätte ich gesagt: nützlicher. Auch im Tode<br />
nützlicher, im Leben als Mittel gegen die allgemeine Todesfurcht.<br />
Hätte Keller die Fertigstellung des letzten Stücks der ersten Fassung<br />
nicht so überhetzt („das Buch mußte doch ein Ende nehmen"), so besäßen<br />
wir wahrscheinlich eine vielleicht zu redselige, aber gewiß für den Schüler<br />
"Der grüne Heinrich" 279<br />
des "himmelstürmenden" Philosophen charakteristische Todespredigt. Der<br />
grüne Heinrich mußte sterben, weil er mit einem verletzten Gewissen für<br />
ein Amt, für sein Volk nicht mehr paßte, und weil seine Liebeshoffnung<br />
gescheitert war; aber dieser Tod wäre nach dem Plane des Dichters auf<br />
einem heiteren Todeswege erreicht worden. Keller wollte ursprünglich<br />
(Brief an Hettner vom 25. Juni 1855) oder doch zur Zeit der Beendigung<br />
diesem Gedanken drei ganze Kapitel widmen und eine förmliche<br />
Elegie des Todes schreiben. Wir hätten da erfahren, wie in Kellers Seele<br />
der alte Glaube an die Unsterblichkeit sowie an die sehr prekäre Lage im<br />
Jenseits und der neue Glaube an die unbedingte und befriedigende Diesseitigkeit<br />
des Lebens miteinander stritten; kein Zweifel, daß Keller damals<br />
schon, wie seine Dorothea, mit einem gewissen trotzigen Jubel den Unsterblichkeitswahn<br />
verwarf. Vielleicht auf die Unsterblichkeit mit so stolzem<br />
Lachen verzichtete, wie einst der römische Dichter Lucretius.<br />
Als Keller aber fünfundzwanzig Jahre später, auf der Höhe seines<br />
Könnens und seines Erfolges, scheu und widerwillig daran ging, durch<br />
eine rücksichtslose Umarbeitung aus seinem Jugendwerke "ein mehr oder<br />
weniger präsentables und liebenswürdiges Buch zu machen", da entschloß<br />
er sich nach langem Zögern, seinem grünen Heinrich — wie gesagt — das<br />
Weiterleben zu gestatten, und so fiel jede Veranlassung zu einer Todespredigt<br />
fort; aus dem liebebedürftigen Jüngling war ein erklärter alter<br />
Junggesell geworden, und über dem Grabe der Mutter wuchs schon längst<br />
das Gras.<br />
So ist der „Grüne Heinrich" in seiner reifen Fassung zu einem Bekenntnisbuche<br />
geworden, in welchem Keller —neben anderen, weltlicheren<br />
Dingen — seine endgültige Befreiung vom alten Kinderglauben darstellt.<br />
Die Retter des Helden, der Graf und Dorothea, glauben nicht einmal<br />
an die Unsterblichkeit der Seele. Heinrich gehört keiner positiven Religion<br />
mehr an, kaum noch einem blassen, rationalistischen Christentum; der<br />
als Jüngling ein Duell für das Dasein Gottes ausgefochten hat (ein<br />
„Narrengefecht" wird es genannt), benützt jede Gelegenheit zu schalkhaften<br />
Blasphemien. Der Gottsucher hat den Gott nicht gefunden und beruhigt<br />
sich dabei. Er leugnet ihn nicht dogmatisch.<br />
Keller fühlte sich aber zu sehr als magister Helvetiae, um in seinen<br />
Dichtungen auch nur der antichristlichen Überzeugung zu folgen. Dafür<br />
war er zu baumeisterlich angelegt. Was er in einem Briefe an Auerbach<br />
(vom 7. Juni 1860) über die Pflicht eines Poeten sagt, läßt sich ohne Zwang<br />
auf seine dichterberufliche Stellung zur Religion anwenden. Man müsse<br />
die Keime der Zukunft soweit verstärken und verschönern, daß die Leute<br />
noch glauben können: ja, so seien sie. "Kurz, man muß, wie man