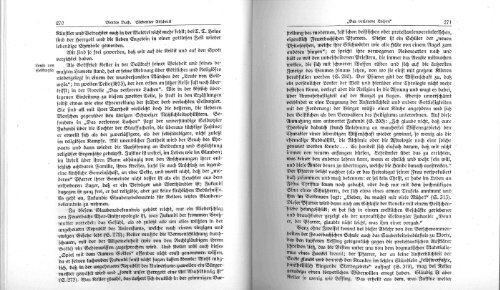Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
270 Viertes Buch. Siebenter Abschnitt<br />
Künstler und Betrachter auch in der Malerei nicht mehr fehlt; bei T. T. Heine<br />
sind der Herrgott und die lieben Engelein in einer gottlosen Zeit wieder<br />
lebendige Symbole geworden.<br />
Wir sind so frei geworden, daß wir auf die Kritik und auf den Spott<br />
verzichtet haben.<br />
Leute von Als Gottfried Keller in der Vollkraft seiner Weisheit und seines bewußten<br />
Humors stand, hat er seine Meinung über Göttliches und Religiöses<br />
niedergelegt in einem der wundersamsten Märchen der "Leute von Seldwyla";<br />
im zweiten Teile (1873), der den ersten an süßer Reife fast noch übertrifft;<br />
in der Novelle "Das verlorene Lachen". Wie in der köstlich überlegenen<br />
Einleitung zu diesem zweiten Teile, so steckt in den Erzählungen<br />
selbst etwas wie eine Ehrenrettung der früher derb verlachten Seldwyler.<br />
Sie sind all mit ihrer Narrheit vielleicht doch die besseren, die lieberen<br />
Menschen gegenüber den übrigen Schweizer Nützlichkeitsphilistern. Besonders<br />
in "Das verlorene Lachen" siegt der unverständige Seldwyler<br />
Jukundi über die Tochter der Stauffacherin, die überaus tüchtige Justine;<br />
er erweist sich als der zuverlässigere, als der selbständigere, nicht zuletzt<br />
im religiösen Kampfe. Mit unendlicher Zartheit wird der Bruch des Ehepaars<br />
und dann wieder die Aussöhnung an Entdeckung und Schlichtung<br />
religiöser Gegensätze geknüpft. Justine ist unfrei, im Leben wie im Glauben;<br />
im Urteil über ihren Mann abhängig von den Anschauungen ihrer entsetzlich<br />
achtbaren Familie, ihres Kreises, sucht sie auch Anschluß an irgendeine<br />
kirchliche Gemeinschaft, an eine Sekte, und merkt nicht, daß der "moderne"<br />
Pfarrer ihrer Gemeinde nicht besser ist als ein Heuchler aus dem<br />
orthodoxen Lager, daß er ein Betrüger und Worthändler ist; Jukundi<br />
dagegen ist ganz frei, er hat religiöse, aber gar keine kirchlichen Bedürfnisse.<br />
Es geht an, Jukundis Glaubensbekenntnis für Kellers letztes Glaubensbekenntnis<br />
zu nehmen.<br />
Zu diesem Glaubensbekenntnis gehört nicht, nur ein Niederschlag<br />
von Feuerbachs Theo-Anthropologie ist, was Jukundi der frommen Großmutter<br />
vorredet: das Gefühl, als ob zuletzt alle um alles wüßten in der<br />
ungeheuern Republik des Universums, welche nach einem einzigen und<br />
ewigen Gesetze lebt (S. 272); Keller mußte die Vermenschlichung durchschauen,<br />
mit der der Allgemeinheit (wie von den Rechtgläubigen ihrem<br />
Gotte) ein Gehirnwissen zugesprochen wird. Und Keller will auch dieses<br />
„Spiel mit dem Namen Gottes" offenbar nicht ernst genommen wissen,<br />
da er seinen lachenden Jukundi sonst nicht sagen lassen könnte: Wohl möglich,<br />
daß in der ungeheuern Republik des Universums zuweilen ein Bürgermeister<br />
gewählt wird und "somit unser Herrgott eine Art Wahlkönig ist"<br />
(S. 273). Was Keller glaubt, das äußert sich deutlich in der grimmigen Dar<br />
"Das verlorene Lachen" 271<br />
stellung des modernen, fast schon deistischen oder protestantenvereinlerischen,<br />
eigentlich Feuerbachschen Pfarrers. Dieser ist ein Schüler der „neuen<br />
Philosophen, welche ihre Stichwörter wie alte Hüte von einem Nagel zum<br />
anderen hingen"; er spricht ihre verwegenen Redensarten nach und<br />
hält es mit den unbescheidenen Priestern, die immer das Neuste mitmachen<br />
wollen, die sich —mit schweren Waffen rüsten und sich auf die äußersten<br />
Zweige des Baumes hinaus setzen, von wo sie einst mit großem Klirren<br />
herabfallen werden (S. 280). Der Pfarrer gibt der Wissenschaft zu, daß<br />
ein persönlicher Lenker der Welt und hierüber eine Theologie nicht mehr<br />
bestehen könne, verlegt aber die Religion in die Ahnung und wagt es dabei,<br />
über Unwahrhaftigkeit auf der Kanzel zu klagen. Ebenso unverschämt<br />
verbindet er eine Leugnung der Unsterblichkeit und andere Gottlosigkeiten<br />
mit der Forderung: der Bürger müsse einer Kirche angehören und sich<br />
den Geistlichen als den Verwaltern des Heiligtums unterordnen. Auf diese<br />
Anmaßung nun antwortet Jukundi (S. 290): "Ich glaube nicht, daß eure<br />
Theologie dadurch (durch Anlehnung an mancherlei Wissensgebiete) den<br />
Charakter einer lebendigen Wissenschaft wieder gewinnt, so wenig als die<br />
ehemalige Kabbalistik, die Alchimie oder die Astrologie noch eine solche<br />
genannt werden könnte ... Es handelt sich einfach darum, daß wir nicht<br />
immer von neuem anfangen dürfen, Lehrämter über das zu errichten,<br />
was keiner den anderen lehren kann, wenn er ehrlich und wahr sein will,<br />
und diese Ämter denen zu übertragen, welche die Hände danach ausstrecken."<br />
Der Pfarrer bricht nachher (als er das Heiratsgut seiner Frau verspekuliert<br />
hat) zusammen und muß bekennen: er sei kein Christ, er habe im Leben an<br />
Jesus Christus kaum noch gedacht, oder doch nur mit dem hochmütigen<br />
Sinn eines Schutzherrn, der sich etwa eines armen Teufels annimmt und<br />
ihm im Vertrauen sagt: "Lieber, du machst mir viele Mühe!" (S. 313).<br />
Dieser Pfarrer wird dann auch am Schlusse der Novelle mit einem Peitschenhiebe<br />
heimgeschickt; er hat sich in einem weltlichen Geschäfte geriebener<br />
und brauchbarer gezeigt als der unpraktische Seldwyler Jukundi: "Denn<br />
er, der Pfarrer, glaubte nicht leicht, was ihm einer vorgab."<br />
Ganz ohne Zweifel kommt bei dieser Abkehr von den Verschwommenheiten<br />
der Feuerbachschen Schule auch das Sauberkeitsbedürfnis zu Worte,<br />
das den tapferen Lessing gelegentlich gegen die protestantischen Aufklärer<br />
schreiben ließ, das die Besten unter uns von dem dogmatischen Materialismus<br />
eines Haeckel trennt; der Pfarrer, der an keine Unsterblichkeit der<br />
Seele glaubt und dennoch den Kranken im letzten Stündlein "selbstverfaßte,<br />
pantheistisch klingende Sterbegebete" aufsagt (S. 315), mag bei Keller<br />
geradezu einen körperlichen Widerwillen erregt haben. Gläubig ist aber<br />
Keller so wenig wie Lessing. Das erhellt aus dem, was Justine weiter