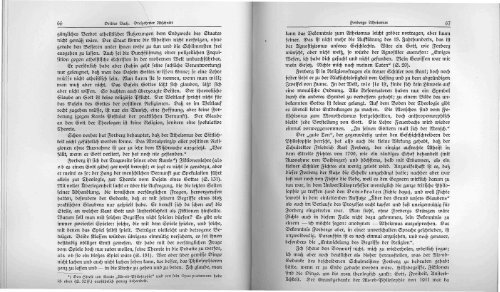Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
66 Drittes Buch. Dreizehnter Abschnitt<br />
gänzliches Verbot atheistischer Äußerungen dem Endzwecke des Staates<br />
nicht gemäß wäre. Der Staat könne die Atheisten nicht verfolgen, ohne<br />
gerade den Besseren unter ihnen wehe zu tun und die Schlimmsten frei<br />
ausgehen zu lassen. Auch sei die Durchführung einer polizeilichen Inquisition<br />
gegen atheistische Schriften in der modernen Welt undurchführbar.<br />
Er persönlich habe aber (dahin geht seine sachliche Verantwortung)<br />
nur geleugnet, daß man das Dasein Gottes wissen könne; so eine Lehre<br />
müsse nicht atheistisch sein. Man kann sie so nennen, wenn man will;<br />
man muß aber nicht. Das Dasein Gottes läßt sich glauben, läßt sich<br />
aber nicht wissen. So dachten auch überzeugte Deisten. Der theoretische<br />
Glaube an Gott ist keine religiöse Pflicht. Der Weltlauf spricht nicht für<br />
das Dasein des Gottes der positiven Religionen. Daß es im Weltlauf<br />
recht zugehen müsse, ist nur ein Wunsch, eine Hoffnung, aber keine Forderung<br />
(gegen Kants Postulat der praktischen Vernunft). Der Glaube<br />
an den Gott der Theologen ist keine Religion, sondern eine spekulative<br />
Theorie.<br />
Schon vorher hat Forberg behauptet, daß der Atheismus der Sittlichkeit<br />
nicht gefährlich werden könne. Das Moralprinzip aller positiven Religionen<br />
ohne Ausnahme ist gar zu sehr dem Mißbrauche ausgesetzt. "Wer<br />
fällt, wenn er Gott verliert, der hat noch nie gestanden."<br />
Forberg ist sich der Tragweite seiner oder Kants*) Fiktionenlehre (als<br />
o b es einen Gott gäbe) gar wohl bewußt; er sagt es nicht so geradezu, aber<br />
er meint es so: der Hang der menschlichen Vernunft zur Spekulation führt<br />
allein zur Theologie, zur Theorie vom Dasein eines Gottes (S. 131).<br />
Mit voller Überlegenheit lacht er über die Aufregung, die die letzten Seiten<br />
seiner Abhandlung, die ironischen verfänglichen Fragen, hervorgerufen<br />
hatten, besonders der Gedanke, daß er mit seinem Begriffe eines bloß<br />
praktischen Glaubens nur gespielt habe. Er beruft sich da schon auf die<br />
Stelle, an welcher Kant Gott und Unsterblichkeit als Fiktionen hinstellte.<br />
Warum soll man mit solchen Begriffen nicht spielen dürfen? Es gibt wie<br />
immer zweierlei Spieler: solche, die mit dem Spiele spielen, und solche,<br />
mit denen das Spiel selbst spielt. Betrüger vielleicht und betrogene Betrüger.<br />
Beide Klassen würden übrigens einmütig versichern, es sei ihnen<br />
beständig völliger Ernst gewesen. Er habe mit der verfänglichen Frage<br />
vom Spiele doch nur raten wollen, seine Theorie in die Debatte zu werfen,<br />
als ob sie ein bloßes Spiel wäre (S. 181). Wer aber über gewisse Dinge<br />
nicht lachen und auch nicht lachen sehen kann, tue besser, das Philosophieren<br />
ganz zu lassen und — in die Kirche zu gehen und zu beten. Ich glaube, man<br />
*) Den Streit um Kants "Als-ob-Philosophie" und um sein Opus postumum habe<br />
ich oben (S. 32 ff.) ausführlich genug behandelt.<br />
Forbergs Atheismus 67<br />
kann das Bekenntnis zum Atheismus leicht gröber vortragen, aber kaum<br />
feiner. Das ist nicht mehr die Aufklärung des 18. Jahrhunderts, das ist<br />
der Agnostizismus unseres Geschlechts. Wäre ein Gott, wie Forberg<br />
wünscht, aber nicht weiß, so würde der Agnostiker ausrufen: "Ewiges<br />
Wesen, ich habe dich gesucht und nicht gefunden. Mein Gewissen war mir<br />
mein Gesetz. Richte mich nach meinen Taten" (S. 29).<br />
Forberg ist in Religionsfragen ein treuer Schüler von Kant; doch noch<br />
fester steht er zu der Rücksichtslosigkeit von Lessing und zu dem abgründigen<br />
Zweifel von Hume. In der Welt, wie sie ist, finde sich kein Hinweis auf<br />
eine moralische Ordnung. Alle Reformatoren haben nur ein Symbol<br />
durch ein anderes Symbol zu verbessern gesucht; zu einem Bilde des unbekannten<br />
Gottes ist keiner gelangt. Auf dem Boden der Theologie gibt<br />
es überall keine Entdeckungen zu machen. Die Menschen sind vom Fetischismus<br />
zum Monotheismus fortgeschritten, doch anthropomorphisch<br />
bleibt jede Vorstellung von Gott. Die Lehre Feuerbachs wird wieder<br />
einmal vorweggenommen. „In seinen Göttern malt sich der Mensch."<br />
Der "gute Ton", der gegenwärtig unter den Geschichtschreibern der<br />
Philosophie herrscht, hat also auch die kleine Wirkung gehabt, daß der<br />
Schulrektor Friedrich Karl Forberg, der einzige aufrechte Atheist in<br />
dem Streite Fichtes von 1799, wie ein räudiges Schaf behandelt (mit<br />
Ausnahme von Vaihinger) und höchstens, halb mit Erbarmen, als ein<br />
kleiner Schüler Fichtes ein wenig gelobt wird. Unzweifelhaft ist es, daß<br />
dieser Forberg der Katze die Schelle umgehängt hatte; nachher aber war<br />
fast nur noch von Fichte die Rede, weil es den Gegnern wirklich darum zu<br />
tun war, in dem Universitätsprofessor womöglich die ganze kritische Philosophie<br />
zu treffen (und den Demokraten Fichte dazu), und weil Fichte<br />
sowohl in dem einleitenden Aufsatze "Über den Grund unsers Glaubens"<br />
als auch im Verlaufe des Prozesses recht tapfer und fast uneigennützig für<br />
Forberg eingetreten war. Man sieht, ohne Forbergs Drängen wäre<br />
Fichte auch in diesem Falle nicht dazu gekommen, sein Bekenntnis zu<br />
einem —ich möchte sagen: anodynen —Atheismus auszusprechen. Das<br />
Bekenntnis Forbergs aber, in einer unverschulten Sprache geschrieben, ist<br />
unzweideutig. Daraufhin ist es noch einmal anzusehen, und noch genauer,<br />
besonders die "Entwickelung des Begriffs der Religion".<br />
Ich scheue den Vorwurf nicht, mich zu wiederholen, wörtlich sogar;<br />
ich muß aber noch deutlicher als bisher herausstellen, was der Als-ob-<br />
Gedanke des bescheidenen Schulmeisters Forberg zu bedeuten gehabt<br />
hätte, wenn er zu Ende gedacht worden wäre. Hilfsbegriffe, Fiktionen<br />
sind die Dinge, um die man theologisch zankt: Gott, Freiheit, Unsterblichkeit.<br />
Der Grundgedanke der Als-ob-Philosophie von 1911 war da