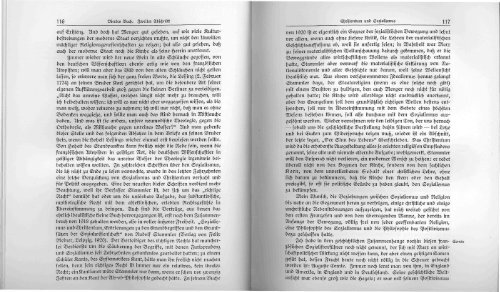Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
116 Viertes Buch. Zweiter Abschnitt<br />
auf Existenz. Und doch hat Menger gut gesehen, auf wie viele Kulturbestrebungen<br />
der moderne Staat verzichten mußte, um nicht den Unwillen<br />
mächtiger Religionsgenossenschaften zu reizen; hat also gut gesehen, daß<br />
auch der moderne Staat noch die Kirche als seine Herrin anerkennt.<br />
Immer wieder wird der neue Wein in alte Schläuche gegossen, von<br />
den deutschen Wissenschaftlern ebenso artig wie von den französischen<br />
Utopisten; will man aber das Bild von den alten Schläuchen nicht gelten<br />
lassen, so erinnere man sich der ganz freien Worte, die Lessing (2. Februar<br />
1774) an seinen Bruder Karl gerichtet hat, um die besondere Art seiner<br />
eigenen Aufklärungsarbeit groß gegen die kleinen Berliner zu verteidigen.<br />
"Nicht das unreine Wasser, welches längst nicht mehr zu brauchen, will<br />
ich beibehalten wissen: ich will es nur nicht eher weggegossen wissen, als bis<br />
man weiß, woher reineres zu nehmen; ich will nur nicht, daß man es ohne<br />
Bedenken weggieße, und sollte man auch das Kind hernach in Mistjauche<br />
baden. Und was ist sie anders, unsere neumodische Theologie, gegen die<br />
Orthodoxie, als Mistjauche gegen unreines Wasser?" Und man gedenke<br />
dieser Stelle und des folgenden Absatzes in dem Briefe an seinen Bruder<br />
stets, wenn die Hoheit Lessings wieder einmal erst bewiesen werden sollte.<br />
Von Hoheit des Standpunktes kann freilich nicht die Rede sein, wenn die<br />
französischen Utopisten in geistiger Not, die deutschen Wissenschaftler in<br />
geistiger Abhängigkeit das unreine Wasser der Theologie irgendwie beibehalten<br />
wissen wollten. In zahlreichen Schriften über den Sozialismus,<br />
die ich nicht zu Ende zu lesen vermochte, wurde in den letzten Jahrzehnten<br />
eine solche Verquickung von Sozialismus und Christentum versucht und<br />
für Politik ausgegeben. Eine der neuesten dieser Schriften verdient mehr<br />
Beachtung, weil ihr Verfasser Stammler ist, der sich um das „richtige<br />
Recht" bemüht hat oder um die unlösbare Aufgabe, das substantivische,<br />
mythologische Recht mit dem adjektivischen, erlebten Rechtsgefühle in<br />
Übereinstimmung zu bringen. Auch sind die Vorträge, aus denen das<br />
ehrlich idealistische kleine Buch hervorgegangen ist, erst nach dem Zusammenbruch<br />
von 1918 gehalten worden, also in voller äußerer Freiheit. "Sozialismus<br />
und Christentum, Erörterungen zu den Grundbegriffen und den Grundsätzen<br />
der Sozialwissenschaft" von Rudolf Stammler (Verlag von Felix<br />
Meiner, Leipzig, 1920). Der Verteidiger des richtigen Rechts hat mancherlei<br />
Verdienste um die Säuberung der Begriffe, mit denen Jurisprudenz<br />
und Sozialismus seit Jahrzehnten gedankenlos gearbeitet hatten; zu einem<br />
Schüler Kants, des Systematikers Kant, hätte man ihn freilich nicht machen<br />
sollen, denn sein richtiges Recht ist immer nur ein relatives, kein ideales<br />
Recht; ein Kantianer wäre Stammler nur dann, wenn er schon vor zwanzig<br />
Jahren an den Kant der Als-ob-Philosophie gedacht hätte. In seinem Buche<br />
Christentum und Sozialismus 117<br />
von 1920 ist er eigentlich ein Gegner der sozialistischen Bewegung und lehnt<br />
vor allem, wenn auch ohne tiefere Kritik, die Lehren der materialistischen<br />
Geschichtsauffassung ab, weil sie unfertig seien; in Wahrheit war Marx<br />
zu seiner materialistischen Weltanschauung dadurch gekommen, daß er die<br />
Beweggründe alles wirtschaftlichen Wollens als materialistisch erkannt<br />
hatte, Stammler aber verwarf die materialistische Erklärung von Nationalökonomie<br />
und aller Geschichte nur darum, weil seine Weltansicht<br />
idealistisch war. Aus einem verschwommenen Idealismus heraus gelangt<br />
Stammler dazu, der Staatsreligion (wenn es eine solche noch gibt)<br />
mit einem Brustton zu huldigen, den auch Menger noch nicht für nötig<br />
gehalten hatte; die Kirche wird allerdings nicht ausdrücklich anerkannt,<br />
aber das Evangelium soll dem grundsätzlich richtigen Wollen bestens entsprechen,<br />
soll nur in Übereinstimmung mit dem Gebote eines höchsten<br />
Wesens bestehen können, soll also durchaus mit dem Sozialismus ausgesöhnt<br />
werden. Wieder vernehmen wir den leidigen Ton, der uns hernach<br />
— sobald uns die geschichtliche Darstellung dahin führen wird — bei Lotze<br />
und bei Eucken zum Widerspruche reizen muß, wieder ist ein Abschnitt,<br />
der letzte sogar, "Der Sinn des Lebens" überschrieben. Das Christentum<br />
wird da die erhabenste Ausgestaltung alles je erlebten religiösen Empfindens<br />
genannt, seine alte und niemals alternde Aufgabe; wohlgemerkt, Stammler<br />
will den Anspruch nicht verlieren, ein moderner Mensch zu heißen: er redet<br />
überall nicht von den Dogmen der Kirche, sondern von dem sachlichen<br />
Kern, von dem unverlierbaren Gehalt einer christlichen Lehre, ohne<br />
sich darum zu bekümmern, daß die Kirche den Kern oder den Gehalt<br />
preisgibt, so oft sie politische Gründe zu haben glaubt, den Sozialismus<br />
zu bekämpfen.<br />
Mein Wunsch, die Beziehungen zwischen Sozialismus und Religion<br />
bis nahe an die Gegenwart heran zu verfolgen, einige christliche und einige<br />
unchristliche Nebenströmungen aufzuzeigen, hat mich weitab geführt von<br />
den ersten Franzosen und von dem überragenden Manne, der bereits im<br />
Anfange der Bewegung, völlig frei von jeder geoffenbarten Religion,<br />
eine Philosophie des Sozialismus und die Philosophie des Positivismus<br />
dazu geschaffen hatte.<br />
Ich habe in dem geschichtlichen Zusammenhange vorhin diesen französischen<br />
Sozialistenführer noch nicht genannt, der sich mit Marx an wirtschaftpolitischer<br />
Wirkung nicht messen kann, der aber einen geistigen Samen<br />
gesät hat, dessen Frucht heute noch nicht völlig in die Scheuer gebracht<br />
worden ist: Auguste Comte. Immer noch lernt man von ihm, in England<br />
und Amerika, in Frankreich und in Deutschland. Seine geschichtliche Weltansicht<br />
war ebenso groß wie die Hegels; er war mit seinem Positivismus