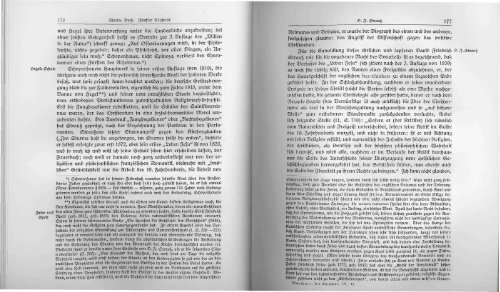Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
176 Viertes Buch. Fünfter Abschnitt<br />
und Hegel ihre Unterwerfung unter die Landeskirche anzukreiden; bei<br />
einer solchen Gelegenheit heißt es (Vorrede zur 3. Auflage des "Willen<br />
in der Natur") schroff genug: "Auf Offenbarungen wird, in der Philosophie,<br />
nichts gegeben; daher ein Philosoph, vor allen Dingen, ein Ungläubiger<br />
sein muß." Schopenhauer, nicht Spinoza, verdient den Ehrennamen<br />
eines Fürsten des Atheismus.*)<br />
Hegels Schute Schopenhauers Hauptwerk in seiner ersten Auflage (von 1819), die<br />
übrigens auch noch nicht die polemisch hinreißende Kraft der späteren Werke<br />
besaß, war (wie gesagt) kaum beachtet worden; die deutsche Geistesbewegung<br />
blieb bis zur Julirevolution, eigentlich bis zum Jahre 1848, unter dem<br />
Banne von Hegel**) und seiner vom preußischen Staate begünstigten,<br />
vom orthodoxen Protestantismus zurechtgestutzten Religionsphilosophie.<br />
Erst die Junghegelianer rebellierten, weil sie Schüler des Saintsimonismus<br />
waren, der das Christentum in eine sozial-humanitäre Moral umzudeuten<br />
suchte. Den Ausdruck "Junghegelianer" oder "Rechtshegelianer"<br />
hat Strauß geprägt, nach der Bezeichnung der Parteien in den Parlamenten.<br />
Straußens letzter Sturmangriff gegen den Kirchenglauben<br />
(„Im Sturme hast du angefangen, im Sturme sollst du enden", dichtete<br />
er selbst) erfolgte zwar erst 1872, aber sein erstes "Leben Jesu" ist von 1835,<br />
und so muß ich und will ich seine Gestalt schon hier erscheinen lassen, vor<br />
Feuerbach; auch weil er damals noch ganz unbeeinflußt war von der religiösen<br />
und philosophischen französischen Romantik, vielmehr mit „deutscher"<br />
Gründlichkeit nur die Arbeit des 18. Jahrhunderts, die Arbeit von<br />
*) Schopenhauer hat in seinem Judenhaß manches schnöde Wort über den Amsterdamer<br />
Juden gesündigt; er muß ihn aber doch sehr hoch gestellt haben, da er sich einmal<br />
(Neue Paralipomena § 629) — fast kindisch — rühmte, ganz genau 111 Jahre nach Spinoza<br />
geboren worden zu sein: das eitle Spiel rechnet auch noch den Geburtstag Schopenhauers<br />
aus dem Todestage Spinozas heraus.<br />
**) Eigentlich wirkten überall auch die Erben von Kants bestem Kritizismus nach, die<br />
Neu-Kantianer, die sich nur nicht so nannten. Zwei Menschenalter, bevor ein neues Geschlecht<br />
Fries und den alten Fries zum führenden Philosophen zu ernennen suchte, hatte bereits Ernst Friedrich<br />
Apelt (geb. 1815, gest. 1859) den Deismus dieses rationalistischen Kantianers erneuert.<br />
Schon in seinem lesenswerten Buche "Die Epochen der Geschichte der Menschheit" (1845),<br />
das noch nicht die Religion zum Hauptgegenstande hat. In einem Kapitel über das Verhältnis<br />
der religiösen Entwicklung zur Philosophie und Naturwissenschaft (1, S. 306--375)<br />
begründet er vorurteilslos und oft anregend die damals noch überraschende Meinung, daß<br />
nicht durch die Reformation, sondern durch die physikalischen Entdeckungen die Aufklärung<br />
und die Befreiung des Staates von der Übermacht der Kirche herbeigeführt worden sei.<br />
Vielleicht stand er bereits unter dem Einflusse von D. F. Strauß, als er die folgenden Sätze<br />
niederschrieb (S. 320): „Das Gewand der Mythen, das noch heut am Tage die religiöse<br />
Wahrheit umgibt, wird einst fallen; der Glaube an den Gekreuzigten so gut wie der an den<br />
arabischen Propheten oder die Gegenwart des Buddha in der Person des Dalai Lama. Es<br />
wird eine Zeit kommen, wo man nicht mehr glauben wird im Vertrauen auf die göttliche<br />
Sendung eines Propheten, sondern kraft der Einsicht in des Geistes eigene Wahrheit. Alsdann,<br />
wann diese Zeit erfüllet ist, wird die Wahrheit ihr Licht nicht mehr von dem trügerischen<br />
D. F. Strauß 177<br />
Reimarus und Voltaire, er wurde der Biograph des einen und des anderen,<br />
fortzusetzen glaubte: den Angriff der Wissenschaft gegen das positive<br />
Christentum.<br />
Für die Entwicklung dieses ehrlichen und tapferen David Friedrich D.F.Strauß<br />
Strauß wie für die ungeheure Macht des Vorurteils ist es bezeichnend, daß<br />
der Verfasser des "Leben Jesu" (ich zitiere nach der 3. Auflage von 1839)<br />
es noch für richtig hält, den Namen eines Freigeistes abzulehnen, er, der<br />
das Hauptgeschäft der englischen free-thinkers zu einem siegreichen Ende<br />
geführt hatte. In der Schlußabhandlung, nachdem er jedes wunderbare<br />
Ereignis im Leben Christi (nicht die Person selbst) als eine Mythe nachgewiesen<br />
hatte, die gesamte Christologie also zerstört hatte, bevor er nach dem<br />
Rezepte Hegels (das Vernünftige ist auch wirklich) die Idee des Christentums<br />
als real in der Menschengattung nachzuweisen und so "auf höhere<br />
Weise" zum orthodoxen Standpunkte zurückzulenken versuchte, findet<br />
sich folgende Stelle (II, S. 719): "Sofern er (der Kritiker) sich nämlich<br />
vom Naturalisten und Freigeist unterscheidet, sofern seine Kritik im Geiste<br />
des 19. Jahrhunderts wurzelt, und nicht in früheren: ist er mit Achtung<br />
vor jeder Religion erfüllt, und namentlich des Inhalts der höchsten Religion,<br />
der christlichen, als identisch mit der höchsten philosophischen Wahrheit<br />
sich bewußt, und wird also, nachdem er im Verlaufe der Kritik durchaus<br />
nur die Seite des Unterschieds seiner Überzeugung vom christlichen Geschichtsglauben<br />
hervorgekehrt hat, das Bedürfnis fühlen, nun ebenso auch<br />
die Seite der Identität zu ihrem Rechte zu bringen." Ich kann nicht glauben,<br />
Dämmerschein der Sage borgen, sondern durch sich selbst heilig sein." Eine nicht ganz selbständige,<br />
doch gute Übersicht über die Geschichte des englischen Deismus und der Toleranzforderung<br />
führt zu der Form, die diese Gedanken in Deutschland gewannen, durch Kant und<br />
dann über Schelling und Hegel hinweg durch Fries. Bemerkenswert an dieser Skizze der<br />
neueren Religionsphilosophie scheint mir eine nicht einmal schlecht begründete Abneigung<br />
gegen den Pantheismus Spinozas; die natura naturans scheint ihm eine leere Abstraktion,<br />
ohne Dasein, ohne Wirklichkeit, ein Unding, ein bloßes Wort. Apelt hat darin Recht behalten,<br />
daß der Spinozismus, wie die Folgezeit gelehrt hat, keinen Schutz gewährte gegen die Ausbreitung<br />
des Materialismus und des Monismus, wenigstens nicht der landläufige Spinozismus<br />
der nüchternen Gesellen, die sich bei uns Spinozisten nennen. Über das Ganze des<br />
Kantischen Systems macht der Friesianer Apelt vortreffliche Bemerkungen, besonders die,<br />
daß Kants Vorstellungen von der Teleologie schon sehr früh feststanden, lange vor seinen<br />
entscheidenden erkenntniskritischen Gedanken, daß daher ein durchgehender Widerspruch in<br />
Kants System trat, sein transzendentales Vorurteil, und daß darum eine Fortbildung der<br />
Kantischen Lehre durch Fries und durch dessen Überwindung des transzendentalen Vorurteils<br />
notwendig wurde; was übrigens weniger gegen Kant selbst gerichtet ist, als gegen Fichte,<br />
Schelling und Hegel. (Man würde heute übrigens das transzendentale Vorurteil auch an<br />
Schopenhauer bemerken und tadeln.) Fries verhalte sich zu Kant wie Newton zu Kepler.<br />
Jakob Friedrich Fries (geb. 1773, gest. 1843) hat aber die "Kritik der Urteilskraft" höher<br />
gestellt als die beiden anderen, berühmteren Kritiken. Er hat die Metaphysik abgelehnt und in<br />
Kant fast nur den bahnbrechenden Psychologen und Anthropologen gefeiert; religiöse Gegenstände<br />
gehören nicht zu den „Erscheinungen", von denen allein wir etwas wissen können.