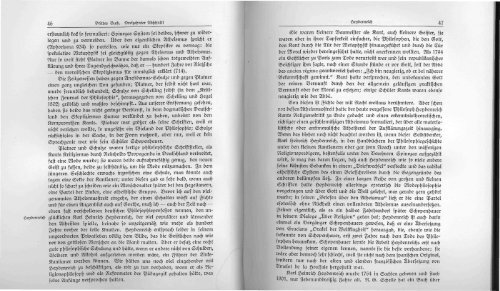Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
46 Drittes Buch. Dreizehnter Abschnitt<br />
erstaunlich keck so formuliert: Spinozas System sei beides, schwer zu widerlegen<br />
und zu vermeiden. Über den eigentlichen Atheismus spricht er<br />
(Aphorisma 934) so parteilos, wie nur ein Skeptiker es vermag: die<br />
spekulative Metaphysik sei gleichgültig gegen Theismus und Atheismus.<br />
Nur so weit steht Platner im Banne der damals schon totgeweihten Aufklärung<br />
und ihres Tugendgeschwätzes, daß er — hundert Jahre vor Nietzsche<br />
— den moralischen Skeptizismus für unmöglich erklärt (714).<br />
Die Zeitgenossen haben gegen Änesidemus-Schulze und gegen Platner<br />
einen ganz ungleichen Ton gefunden; Platner, der selbst nicht hart war,<br />
wurde freundlich behandelt, Schulze von Schelling selbst (in dem „Kritischen<br />
Journal der Philosophie", herausgegeben von Schelling und Hegel<br />
1802) gröblich und maßlos beschimpft. Aus unserer Entfernung gesehen,<br />
haben sie beide das nicht geringe Verdienst, in dem dogmatischen Deutschland<br />
den Skeptizismus Humes verkündet zu haben, unbeirrt von den<br />
Kompromissen Kants. Platner war größer als seine Schriften, weil er<br />
nicht verletzen wollte, so ungefähr ein Wieland der Philosophie; Schulze<br />
rücksichtslos in der Sache, in der Form maßvoll, aber nur, weil er kein<br />
Sprachgenie war wie sein Schüler Schopenhauer.<br />
Platner und Schulze waren fertige philosophische Schriftsteller, als<br />
Kants Kritizismus durch Reinholds Propaganda in Deutschland verbreitet,<br />
fast eine Mode wurde; sie waren beide aufnahmefähig genug, den neuen<br />
Geist zu fassen, beide zu selbständig, um die Mode mitzumachen. In dem<br />
jüngeren Geschlechte erwuchs inzwischen eine Schule, man könnte auch<br />
sagen eine Sekte der Kantianer; unter diesen gab es sehr bald, wenn auch<br />
nicht so scharf zu scheiden wie ein Menschenalter später bei den Hegelianern,<br />
eine Partei der Linken, eine atheistische Gruppe. Bevor ich auf den vielgenannten<br />
Atheismusstreit eingehe, der einen Schatten wirft auf Fichte<br />
und für einen Augenblick auch auf Goethe, muß ich — auch der Zeit nach —<br />
einen fast verschollenen deutschen Philosophieprofessor nennen, den unglücklichen<br />
Karl Heinrich Heydenreich, der viel populärer und lärmender<br />
den Atheisten spielte, beinahe so unzeitgemäß wie mehr als hundert<br />
Jahre vorher der tolle Knutsen. Heydenreich entsprach leider in seinem<br />
ungeordneten Privatleben völlig dem Bilde, das die Geistlichen nach wie<br />
vor von gottlosen Menschen an die Wand malten. Aber er besaß eine recht<br />
gute philosophische Schulung und hätte, wenn er anders nicht von Schulden,<br />
Weibern und Alkohol aufgerieben worden wäre, ein Führer der Links-<br />
Kantianer werden können. Wir hätten uns noch viel eingehender mit<br />
Heydenreich zu beschäftigen, als wir zu tun vorhaben, wenn er als Religionsphilosoph<br />
und als Reformator der Pädagogik gehalten hätte, was<br />
seine Anfänge versprochen hatten.<br />
Heydenreich 47<br />
Sie waren kleinere Baumeister als Kant, auch kleinere Geister, sie<br />
waren aber in ihrer Tapferkeit einfacher, die Philosophen, die den Gott,<br />
den Kant durch die Tür der Metaphysik hinausgeführt und durch die Tür<br />
der Moral wieder hereingeführt hatte, nicht anerkennen wollten. Als 1794<br />
ein Geistlicher zu Paris zum Tode verurteilt war und sein republikanischer<br />
Beichtiger ihm sagte, nach einer Stunde stünde er vor Gott, soll der Abbé<br />
des ancien régime geantwortet haben: "Ich bin neugierig, ob er bei näherer<br />
Bekanntschaft gewinnt." Kant hatte versprochen, den unbekannten Gott<br />
der reinen Vernunft durch den der allgemein geläufigen praktischen<br />
Vernunft oder der Moral zu ersetzen; einige Schüler Kants waren ebenso<br />
neugierig wie der Abbé.<br />
Von diesen ist Fichte der mit Recht weitaus berühmtere. Aber schon<br />
vor dessen Atheismusstreit hatte der heute vergessene Philosoph Heydenreich<br />
Kants Religionskritik zu Ende gedacht und einen erkenntnistheoretischen,<br />
richtiger einen gefühlsmäßigen Atheismus formuliert, der über alle materialistische<br />
oder antimoralische Atheisterei der Aufklärungszeit hinausging.<br />
Wenn das bisher noch nicht beachtet worden ist, wenn dieser Selbstdenker,<br />
Karl Heinrich Heydenreich, in den Handbüchern der Philosophiegeschichte<br />
unter den kleinen Kantianern oder gar (von Noack) unter den wässerigen<br />
Religionspredigern, bestenfalls unter den Verehrern Spinozas aufgezählt<br />
wird, so mag das daran liegen, daß auch Heydenreich wie so viele andere<br />
seine kühnsten Gedanken in einem "Briefwechsel" versteckte und das radikal<br />
atheistische System des einen Briefschreibers durch die Gegengründe des<br />
anderen bekämpfen ließ. In einer langen Reihe von großen und kleinen<br />
Schriften hatte Heydenreich allerdings exoterisch die Modephilosophie<br />
vorgetragen und über Gott und die Welt gelehrt, was gerade gern gehört<br />
wurde; in seinen „Briefen über den Atheismus" ließ er die eine Partei<br />
esoterisch ohne Rückhalt einen vollendeten Atheismus auseinandersetzen.<br />
Feiner eigentlich, als es ein halbes Jahrhundert später Schopenhauer<br />
in seinem Dialoge „Über Religion" getan hat; Heydenreich ist auch darin<br />
einmal ein Vorgänger Schopenhauers gewesen, daß er eine Übersetzung<br />
von Gracians „Orakel der Weltklugheit" herausgab, die, ebenso wie die<br />
bekannte von Schopenhauer, erst zwei Jahre nach dem Tode des Philosophen<br />
herauskam. Schopenhauer lernte die Arbeit Heydenreichs erst nach<br />
Vollendung seiner eigenen kennen, nannte sie die beste vorhandene; sie<br />
wäre aber dennoch sehr schlecht, weil sie nicht nach dem spanischen Original,<br />
sondern nur nach der alten und elenden französischen Übersetzung von<br />
Amelot de la Houssaie hergestellt war.<br />
Karl Heinrich Heydenreich wurde 1764 in Sachsen geboren und starb<br />
1801, nur siebenunddreißig Jahre alt. R. G. Schelle hat ein Buch über