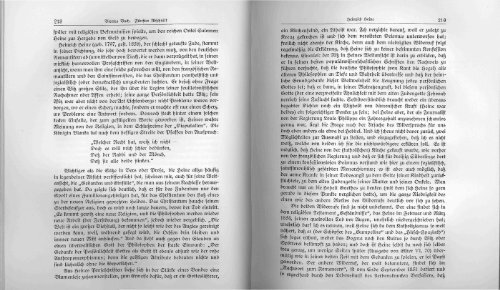Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Band 4 - m-presse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
218<br />
Viertes Buch. Fünfter Abschnitt<br />
später mit religiösen Bekenntnissen spielte, um den reichen Onkel Salomon<br />
Heine zur Hergabe von Geld zu bewegen.<br />
Heinrich Heine (geb. 1797, gest. 1856), der schlecht getaufte Jude, stammt<br />
in seiner Dichtung, die sehr hoch bewertet werden muß, von den deutschen<br />
Romantikern ab (unmittelbar von Tieck), die er dann verprügelt hat, in seinen<br />
wirklich humorvollen Prosaschriften von den Engländern, in seiner Weltansicht,<br />
wenn man ihm eine solche zusprechen will, von den französischen Romantikern<br />
und den Saintsimonisten, die das Christentum pantheistisch und<br />
sozialistisch (oder demokratisch) umzudeuten suchten. Er besaß ohne Frage<br />
einen Witz großen Stils, der ihn über die Legion seiner feuilletonistischen<br />
Nachahmer oder Affen erhebt; seine ganze Persönlichkeit hatte Witz; sein<br />
Witz war aber nicht von der Art Lichtenbergs: nicht Probleme waren verborgen,<br />
wo er einen Scherz machte, sondern er machte oft nur einen Scherz,<br />
wo Probleme eine Antwort fordern. Dennoch steckt hinter einem solchen<br />
kecken Einfalle, der zum geflügelten Worte geworden ist, Heines wahre<br />
Meinung von der Religion, in dem Schlußreime der "Disputation". Die<br />
Königin Blanka tut nach dem heftigen Streite der Pfaffen den Ausspruch:<br />
"Welcher Recht hat, weiß ich nicht —<br />
Doch es will mich schier bedünken,<br />
Daß der Rabbi und der Mönch,<br />
Daß sie alle beide stinken."<br />
Wichtiger als die Sätze in Vers oder Prosa, die Heine allzu häufig<br />
in irgendeiner Absicht veröffentlicht hat, scheinen mir, auch für seine Weltansicht,<br />
die „Gedanken und Einfälle", die man aus seinem Nachlasse herausgegeben<br />
hat. Da zeigte sich deutlich, daß er für das Judentum nur den<br />
Spott eines Familienangehörigen hat, für das Christentum den Haß eines<br />
zu der neuen Religion gepreßten Heiden. Das Christentum hauche seinen<br />
Sterbeseufzer aus, doch es wird noch lange dauern, bevor der Tod eintritt.<br />
"Es kommt gewiß eine neue Religion, und die Philosophen werden wieder<br />
neue Arbeit (der Zerstörung) bekommen", jedoch wieder vergeblich. "Die<br />
Welt ist ein großer Viehstall, der nicht so leicht wie der des Augias gereinigt<br />
werden kann, weil, während gefegt wird, die Ochsen drin bleiben und<br />
immer neuen Mist anhäufen." Und da steht auch gegen den Glauben an<br />
einen überweltlichen Gott der Philosophen der starke Einwand: "Der<br />
Gedanke der Persönlichkeit Gottes als Geist ist ebenso absurd wie der rohe<br />
Anthropomorphismus; denn die geistigen Attribute bedeuten nichts und<br />
sind lächerlich ohne die körperlichen."<br />
Aus Heines Prosaschriften ließe sich in der Stärke eines <strong>Band</strong>es eine<br />
Blumenlese zusammenstellen, zum Erweise dafür, daß er ein Gotteslästerer,<br />
Heinrich Heine 219<br />
ein Kirchenfeind, ein Atheist war. Ich verzichte darauf, weil er zuletzt zu<br />
Kreuz gekrochen ist und sich dem veralteten Deismus unterworfen hat;<br />
freilich nicht ebenso der Kirche, denn auch dem niedrigsten Widerruf folgt<br />
regelmäßig die Erklärung, daß Heine sich zu keiner bestimmten Konfession<br />
bekenne. Einerlei: der Riß in Heines Weltansicht ist darin zu erblicken, daß<br />
er in seinen besten populärwissenschaftlichen Schriften den Nachweis zu<br />
führen versuchte, daß die deutsche Philosophie (von Kant bis Hegel) alle<br />
älteren Philosophien an Tiefe und Wahrheit übertreffe und daß der heimliche<br />
Grundgedanke dieser Weltweisheit die Leugnung jedes persönlichen<br />
Gottes sei; daß er dann, in seiner Matratzengruft, bei diesem persönlichen<br />
Gotte (der eine verzweifelte Ähnlichkeit mit dem alten Judengotte Jehovah<br />
verriet) seine Zuflucht suchte. Selbstverständlich braucht weder ein überaus<br />
begabter Dichter noch ein Witzbold von dämonischer Kraft (Heine war<br />
beides) ein folgerichtiger Denker zu sein; bei Heine aber, der als Journalist<br />
von der Regierung Louis Philipps ein Jahresgehalt anzunehmen schamlos<br />
genug war, liegt die Frage nach der Ursache des Widerspruchs für uns<br />
doch eben anders als etwa bei Hebbel. Und ich scheue nicht davor zurück, zwei<br />
Möglichkeiten zur Auswahl zu stellen, und einzugestehen, daß ich es nicht<br />
weiß, welche von beiden ich für die nichtswürdigere erklären soll. Es ist<br />
möglich, daß Heine von der (katholischen) Kirche gekauft wurde, wie vorher<br />
von der französischen Regierung und daß er sich für dreißig Silberlinge dort<br />
zu einem konfessionslosen Deismus verstand wie hier zu einem sozialistisch,<br />
saintsimonistisch gefärbten Monarchismus; es ist aber auch möglich, daß<br />
der arme Kranke in seiner Todesangst zu dem Gotte seiner Kindheit zurückflüchtete,<br />
zu dem alten Judengotte seiner Mutter und seines Onkels. Man<br />
braucht nur an die Hoheit Goethes zu denken (mit dem sich Heine so gern<br />
gerade in diesem Punkte verglichen hatte), um die ganze Niedrigkeit des<br />
einen wie des andern Motivs des Widerrufs deutlich vor sich zu sehen.<br />
Die beiden Widerrufe sind ja nicht unbekannt. Der eine findet sich in<br />
dem religiösen Testament "Geständnisse", das Heine im Februar und März<br />
1854, seinen qualvollen Tod vor Augen, unehrlich niedergeschrieben hat;<br />
unehrlich darf ich es nennen, weil Heine sich da dem Katholizismus so weit<br />
nähert, daß er (der Schöpfer des "Gumpelino" und des "Hirsch-Hyazinth")<br />
sich sogar rühmt, weder das Dogma noch den Kultus je durch Witz oder<br />
Spötterei bekämpft zu haben; und doch ist Heine selbst da noch sich selber<br />
treu genug, um wenige Seiten später (Ausgabe von Elster VI, 70) übermütig<br />
wie in seiner besten Zeit mit dem Gedanken zu spielen, er sei Papst<br />
geworden. Der andere Widerruf, der weit bekanntere, findet sich im<br />
„Nachwort zum Romancero", ist von Ende September 1851 datiert und<br />
so ergreifend durch den Lebensdurst des sterbenskranken Verfassers, daß